Zürich – Beijing – Zürich auf dem Landweg
Dieser Bericht entstand auf einer Reise im Zeitraum von Juli bis Dezember 2003. Die Texte zur "Ostreise" wurden als sogenannter Blog auf der Internetseite www.ostreise.bitflux.com (nicht mehr online) jeweils nach Abschluss einer Reise-Etappe erstellt und veröffentlicht.
Für diese neue Veröffentlichung wurde der Text inhaltlich minimal überarbeitet, leserinnenfreundlich formatiert und mit einigen wenigen Bildern ergänzt. Für eine umfangreichere BIldstrecke, bitte hier klicken. Schreibfehler oder andere Hinweise zur Verbesserung nehme ich sehr gerne entgegen, da der Text noch von keinem Lektor kritisch durchgesehen wurde.
[Geschätzte Lesezeit für diese rund 45 A4-Seiten: 60 bis 90 Minuten, abhängig von der Reisegeschwindigkeit.]
Wien (Österreich)
Visa battle in Vienna
Ob sich's ausgeht? Na, es wird sich schon ausgehen!
Der Start meiner Ostreise hat im österreichischen Tor zum Osten (neben Istanbul wird auch Wien so genannt) einen würdigen, stimmigen und dank der tollen Gastfreundschaft von Sontscha 'Sonne' Ebner wirklich perfekten Einstieg gefunden. Da ich schon das zweite Mal bei Sontscha zu Besuch sein darf, ist es auch so etwas wie ein nach Hause kommen. Und was könnte ich mir Besseres vorstellen, als diese Reise in einer mehr oder weniger bekannten Umgebung zu beginnen. Denn das Unbekannte wird mich dann noch genug früh fordern - und wohl das eine oder andere Mal auch überfordern.
Wien war deshalb für mich so etwas wie ein Wunschreisestartort. Der erste Schritt auf dieser Reise und somit auch der erste Schritt in Richtung Osten sollte im Nachtzug von Zürich Haupt- nach Wien Westbahnhof erfolgen. Von Wien Westbahnhof gings dann ab in den 20ten Bezirk, genauer an die Adalbert-Stifter-Strasse. Das Stadtzentrum ist fern, die Donau ist nah, ein Ort wo Wien richtig ländlich wirkt. Einzig der Anblick der "Fernwärme Wien" holt mich zurück in die moderne Realität. Die "Fernwärme" ist die wohl schönste Müllverbrennungsanlage der Welt, da sie in bester hundertwasserscher Manier in unkonventionellen Formen und Farben errichtet wurde. Sogar in der Nacht verbreitet das Gebäude einen besonderen Zauber, da der im mächtigen Schlot integrierte zwiebelförmige Luftfilter mit einer grossen Menge von Lichtern verziert ist, welche die Farben ständig ändern.
Im 20ten ist man dem Osten schon sehr nah. Türkische Märkte, Kebab-Stände und östliche Sprachen dominieren das Strassenbild. Doch in wenigen Minuten ist man mit der pünktlichen und sehr häufig ("Zug fährt ein, zurrrrücktreten!") fahrenden U-Bahn im Stadtzentrum und somit an der Maria-Hilferstrasse beim Shopping, beim Steffl auf einer Fiakerfahrt , bei der Karlskirche oder beim Russendenkmal, am Naschmarkt, bei der Oper, beim Parlament oder im Dorotheum. So heissen einige der Touristenziele, die Wien zur Weltstadt und zum begehrten Reiseziel gemacht haben und noch immer machen.
, bei der Karlskirche oder beim Russendenkmal, am Naschmarkt, bei der Oper, beim Parlament oder im Dorotheum. So heissen einige der Touristenziele, die Wien zur Weltstadt und zum begehrten Reiseziel gemacht haben und noch immer machen.
"Oder willst du doch eher nach Pötzleinsdorf, zum Türkenschanzplatz oder beim Heurigen ein paar Grammeln verdrücken? Noch ein lackerl Kaffee gefällig?"
"Nein danke, passt schon."
Da die Wiener Bausubstanz aus vorigen Jahrhunderten stammt, sieht man immer wieder einen Rauchfangkehrmeister bei der Arbeit.
"Geh bitte, bist deppert? Schleich dich, was willst du mit einem Rauchfangkehrmeister? Da geh ich schon lieber an den Totalabverkauf an die Maria-Hilfer! Und das alles mit der Umweltstreifenkarte, kostet dich etwa 42 Schilling pro Tag."
"Was ist das doch gleich in Euro?"
"Gemma, gemma, Tante Emma. Und wenn's Dich anleckert, dann nimmst einfach zum Nachtisch Schokoladenpalatschinken mit Schlagobers. Passt!"
Ich habe Wien genossen, doch zugleich musste ich mich auch ziemlich intensiv mit dem weiteren Verlauf meiner Reise befassen. Besondere Aufmerksamkeit musste ich auf diejenigen Länder lenken, die ich demnächst besuchen möchte, einen solchen Besuch aber nur für eine beschränkte Zeit und gegen Vorweisung eines Visums zulassen. Ungarn und Rumänien, die voraussichtlich nächsten Reisestationen gehören für meinereiner zum Glück nicht zu den visaverlangenden Ländern.
Doch dann warten schon verführerisch und geheimnisvoll hinter dem Schwarzen und vor dem Kaspischen Meer (je nach Perspektive kann man das natürlich auch umgekehrt sehen) Georgien, Armenien und Aserbaidschan.
Georgien sollte ich via die Ukraine erreichen können, wobei ich in der Ukraine nur Odessa und die Halbinsel Krim besuchen will; um Tschetschenien und Abchasien werde ich ganz sicher einen weiten Bogen machen.
Vor dem ehrwürdigen, wenn auch schon leicht verfallenen Botschaftstempel der Ukraine hatte sich beim meinem Erscheinen um 11 Uhr schon eine ansehnliche Menschentraube gebildet, die unter zunehmenden Unmutskundgebungen auf die Gnade des Türwächters hoffte, um nach zwei oder drei Stunden Wartezeit doch noch eingelassen zu werden. Als ich dann erfuhr, dass das Eingelassen-Werden erst ein kleiner Schritt im Prozess (Kafka lässt grüssen) vom Visums-Begehrer zum Visums-Besitzer ist und dass dieser Prozess mindestens sieben Tage dauert, hab ich mich schon ein erstes mal damit befasst, meine Reiseroute zu ändern.
Dann fahr ich halt nicht via die Ukraine in den Kaukasus, mir soll's recht sein. Mal schauen, ob es von Rumänien aus eine Schwarze-Meer-Fähre nach Georgien gibt? Vielleicht von Constanta aus? Oder muss ich nach Bulgarien ausweichen? Oder doch in die Türkei nach Istanbul? Oder "zurück zum Start" nach Genua? (Lesetipp dazu die Kurzgeschichte "Ein schwerer Transport" von Franz Hohler).
Diese Fragen werde ich dann in Budapest zu klären versuchen. Aber noch immer bin ich ja in Bella Vienna, hart auf der Spur meines ersten Visums. Und es geht auch einfacher: Das Personal der georgischen Botschaft, also der Generaloberstudienratsbotschaftsvorsitzende und seine Untertanen haben mir einen äusserst zuvorkommenden Service angeboten.
Begonnen hat es schon damit, dass sie mir ausserhalb der sonst strikt eingehaltenen Öffnungszeiten Einlass in ihre heiligen Hallen gewährten und mir versprachen, dass das Visum binnen dreier Tag bereit sei. Das stimmte mich hoffnungsvoll und ich machte mich auf, die nächste Hürde zu nehmen und die heisst Turkmenistan, das Tor nach Usbekistan. Die Visümer, Visas, Visen, Visa oder so ähnlich von Armenien und Aserbaidschan will ich mir dann in Georgien besorgen, das geht sich dann schon irgendwie aus!
Das turkmenische Visum scheint eine noch grössere Hürde zu sein als das ukrainische, da ich vom äusserst zuvorkommenden und freundlichen Botschaftsrat Bekmurad Astanakulov erfuhr, dass er trotz allem guten Willen nichts machen könne ohne einen turkmenischen "Sponsor", der bereit ist, mir eine "Einladung" auszustellen. Einladung heisst das offizielle Dokument, das zum Beispiel via ein lokales Reisebüro bestellt werden kann (gehen harte Euros, versteht sich!) und eine Einreiseerlaubnis vom turkmenischen Aussenministerium beinhaltet.
Und wie man sich leicht vorstellen kann liegt die Wartefrist für eine solche Einladung im Wochenbereich. Hmm, wie ist das jetzt mit der Reiseplanung? Ich glaube, dann lass ich auch Turkmenistan links liegen! Und dies, obwohl mir Herr Astanakulov versichert hat, dass es sehr sicher sei in seinem Land. Doch wiederum andere Stimmen haben mir eher davon abgeraten, via Turkmenistan nach Usbekistan zu reisen, unter anderem der hier nicht namentlich genannt werden wollende Attache von Usbekistan (Name der Redaktion bekannt). Letzterer wiederum hat mir in geradezu aufopfernder Weise zu einem Visum für sein Land verholfen.
"Was, Sie waren noch nie in Usbekistan? Da müssen Sie sich unbedingt einen Monat Zeit nehmen! Und gehen Sie bitte nicht nur nach Taschkent sondern auch nach Samarkand, Khiva und andere kleine Orte von grosser Schönheit", waren seine Worte und haben eine grosse Vorfreude in mir geweckt.
Mit meinen zwei ersten Visa im Pass reise ich also stolz nach Budapest, um dort mit ungebrochenem Elan weiter auf Visafang zu gehen.
Visum gut, alles gut! Und so nehm ich morgen um acht in der Früh das Tragflügelboot von Wien (aber erst nachdem wir heute Abend nach Schloss Schönbrunn fahren, um beim schon längst ausverkauften R.E.M.-Konzert schwarz mitzuhören) nach Budapest, um fünfeinhalb Stunden später in der ungarischen Metropole einzutreffen.
Das Tragflügelboot ist für mich nur die zweitbeste Wahl, da es sehr schnell über die Donau flitzt und darum den Passagieren nicht erlaubt, auf Deck zu gehen. Doch meine Versuche, bei einem Fracht- oder Tankschiff mitfahren zu können, wurden nicht mit Erfolg gekrönt, denn nach Gesprächen sowohl mit einem Fracht- als auch mit einem Tankschiffkapitän (es waren nicht wirklich die Kapitäne, mit denen ich sprach, aber so tönt es schön, ein bisschen nach Seemannsgarn...) habe ich erfahren, dass es die Zollvorschriften schlicht und einfach nicht zulassen, dass auf einem derartigen Schiff Nicht-Besatzungsmitglieder die Landesgrenze überqueren.
"Wenn sie genug Zeit haben, können sie ja als Matrose anheuern", war der Tipp der erwähnten Auskunftspersonen. Ach geh, das lass ich dann doch besser, denn ich habe für diese Reise leider nur sechs Monate und nicht sechs Jahre Zeit...
Erfrischender als im Zug wird die Flussreise wohl trotzdem sein, hoffe ich wenigstens, auch wenn ich die Nase nicht in den östlichen Fahrtwind strecken kann. Bis denn, Vienna, vielleicht auf ein Wiedersehen im Dezember bei der Rückreise?! Schön war's allemal!
26. Juli 2003
Budapest (Ungarn)
Ein Salto rückwärts verzögert die Weiterreise
Ein bisschen habe ich die Donau also doch noch aus der Fischerperspektive kennen gelernt. Das im letzten Blog erwähnte Tragflügelboot hat mich (und noch 60 andere, meist ziemlich bejahrte Menschen) in weniger als sechs Stunden die 250 Kilometer bis Budapest gebracht, gefahren - oder muss ich sagen: getragen?
Die rasante Fahrt mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h hatte etwas sehr unbootmässig Ruhiges und trotzdem Rasantes, Beschleunigtes an sich. Unbootmässig war auch, dass ich mich eher wie in einem Flugzeug denn wie in (das ist genau der Unterschied: 'in', nicht 'auf') einem Boot befand, dessen Besatzung den Passagieren nur bei Schleusendurchfahrten den Aufstieg an Deck erlaubte.
Doch trotzdem glaube, ich etwas von der Schönheit und der Bedeutung dieses zweitgrössten europäischen Flusses, der im weiteren Verlauf an seiner breitesten Stelle bis zu 1'500 Meter breit wird, erfahren zu haben.
Anmerkung an die Leserin und den Leser: "Touristische Eckdaten" werden ohne Gewähr angegeben.
Wenn ich ab und zu meiner Meinung nach interessante "Facts und Figures" in den Text einfliessen lasse, haben diese verschiedenste Quellen: Reiseführer, Gespräche mit Einheimischen oder sonstigen Kennerinnen, Gerüchte, Gelesenes, vermeintlich Verstandenes oder einfach frei Erfundenes. Doch wie der kleine Prinz (Lese- beziehungsweise Wiederlesetipp: 'Der kleine Prinz', Antoine de Saint-Exupéry) feststellt, sind Zahlen nur etwas für grosse Leute und die sind ja eh sehr seltsam.
Mein Ziel war, im weiteren Verlauf dieser Reise die Donau noch viel besser kennen zu lernen, da ich die Strecke bis ans Schwarze Meer auf diesem - seine eigene Hymne strafenden, da nicht immer so blauen - Fluss zurücklegen wollte.
Doch daraus wird nichts: Heute Abend nehme ich den Zug, um via Bukarest nach Constanta zu gelangen, der grössten und wichtigsten rumänischen Hafenstadt, von wo aus ich dann weiter will. Doch alles schön der Reihe nach...
Nach einigen Tagen Sightseeing in Budapest - einige Wochen wären wohl auch nicht genug gewesen, denn die 2-Millionen-Stadt bietet so viel  und ist so gross, dass man sehr lange verweilen kann, ohne dass es einem langweilig werden würde - konnte ich mich wie erhofft der Artistengruppe um Numa Gaudy und Barbara Von Arx anschliessen. Im Gebäude der Allami Artistaképzö Intezét an der Vérosligeti fasor 3 begann das schweisstreibende Zirkus-Training.
und ist so gross, dass man sehr lange verweilen kann, ohne dass es einem langweilig werden würde - konnte ich mich wie erhofft der Artistengruppe um Numa Gaudy und Barbara Von Arx anschliessen. Im Gebäude der Allami Artistaképzö Intezét an der Vérosligeti fasor 3 begann das schweisstreibende Zirkus-Training.
Die traditionsreiche Schule hat erst kürzlich ihr fünfzigjähriges Bestehen gefeiert. Das Gebäude atmet deutlich den Geruch vergangener, ruhmreicherer Tage und Jahre, abgesehen natürlich vom seit jeher gleich gebliebenen Schweissgeruch... Prächtige Fotos von erfolgreichen und berühmten Artisten welche von dieser Schule aus ihre Manegen-Karriere lanciert hatten, lassen mich Anfänger staunen, ehrfürchtig den Kopf schütteln und machen natürlich auch ein bisschen Hoffnung: "Also wenn diese Künstler das alles hier gelernt haben, dann werden für mich wohl auch ein paar artistische Brosamen abfallen..."
Die Schule hatte - rein äusserlich gesehen- sicher schon bessere Tage gesehen. Doch das ist wohl nichts anderes als ein ehrliches Spiegelbild von ganz Budapest.
Weil aber die Lehrerinnen, Trainer und Vorturnerinnen mit so viel Freude und Einsatz dabei sind, spiel es gar keine Rolle, ob man in einer Garage oder in einer eidgenössisch-technischen Hochschulpolyterrassendreifachturnhalle seine Purzelbäume übt.
Obwohl mir versichert wurde, dass die Trainings in vergangenen Jahren härter und strenger waren, konnte ich mich weder über mangelnde Bewegung noch mangelnde Transpiration beklagen. Gewisse Fortschritte stellten sich ein, wenn natürlich auch nur langsam. Und nun sollte ich diese schöne Stadt mit dieser tollen Trainingsgruppe wie ich es mir vorgenommen hatte schon nach einer Woche Unterricht wieder verlassen?
Das wäre nun wirklich schade, denn die bunte, aus fast allen Alters- und sonstigen Klassen zusammengewürfelte Gruppe versprüht eine solche positive Energie und Lebensfreude, dass ich nichts anderes will, als so lange wie möglich dabei zu sein. Und da ich so toll und vorbehaltlos in dieser Gruppe  aufgenommen worden bin, musste ich ganz einfach bis zum Ende bleiben, welches gestern mit der beeindruckenden Schlussvorführung und der Verabschiedung am Keleti-Bahnhof schneller als gehofft gekommen ist. Und ja, auch ich habe nach diesen zwei Wochen ein Diplom bekommen und auch ich habe einiges gelernt.
aufgenommen worden bin, musste ich ganz einfach bis zum Ende bleiben, welches gestern mit der beeindruckenden Schlussvorführung und der Verabschiedung am Keleti-Bahnhof schneller als gehofft gekommen ist. Und ja, auch ich habe nach diesen zwei Wochen ein Diplom bekommen und auch ich habe einiges gelernt.
Wollt ihr wissen, was?
Nein?
Egal, ich erzähls trotzdem, da es mich mit so grosser Freude erfüllt: Ich habe also fleissig trainiert und geübt, bin ein bitzeli auf dem Seil hin und hergelaufen, habe ein paar Runden auf dem Einrad gedreht, kann nun pantomimisch seilziehen und um Ecken laufen oder Kästen verschieben. Und dann - Trommelwirbel bitte! - bin ich tatsächlich vorgestern meine ersten Saltos gestanden, vorwärts mit Anlauf, rückwärts aus dem Stand! Über die angewendete Technik und die vergebenen Stilnoten wird an dieser Stelle nicht diskutiert, denn Kindheitsträume gehen nicht jeden Tag in Erfüllung.
Salto hin oder her, das Leben geht weiter - wenn auch ab sofort natürlich viel beschwingter, mit mehr Selbstvertrauen, stolzer und jedes kommende Gespräch nicht mit den Worten "Wie geht's?" oder "Schönes Wetter heute" beginnend, sondern mit der herausfordernden Frage "Kannst Du den Salto? ...:)".
Meine Reise nähert sich ab heute Abend, nach den Vorgruppen in Wien und Budapest (überhaupt nicht despektierlich gemeint, denn wer hat es nicht schon erlebt, dass die Vorgruppe besser war als der "Hauptact"?) mit grossen Schritten dem ersten Höhepunkt der Reise, dem Kaukasus.
Rumänien wird von mir auf dieser Reise ganz bewusst zum reinen Transitland degradiert, was aber ganz sicher nicht mit der Schönheit und dem kulturellen Reichtum des Landes zu tun hat, sondern viel mehr damit, dass ich einige wenige Höhepunkte auf meiner Reise setze, auf die ich mich konzentrieren will. Wie schon erwähnt, ein erster solcher Höhepunkt sollten die zentral-kaukasischen Länder Georgien, Armenien und Aserbaidschan werden, wo ich zwischen vier und acht Wochen (merke die exakte Planung) bleiben will.
Georgien, oder genauer wohl die georgische Hafenstadt Batumi, hoffe ich von Constanta aus mit einer Fähre zu erreichen. Ich habe herausgefunden, dass es mindestens eine grosse Gesellschaft gibt, die Frachttransporte von Rumänien nach Georgien durchführt. Ob auf dieser 58-stündigen Reise auch Rucksacktouristen mitfahren dürfen, werde ich sicher bald herausfinden. Den Seeweg nehme ich, weil mir der Landweg via die Ukraine visumstechnisch zu mühsam war und ich nun wirklich noch auf eine rechte Ration Schifffahrt kommen will, denn die Donau scheint von Budapest an Richtung Osten quasi ein "Gewässer non grata" zu sein, wenigstens was den öffentlichen und privaten Personentransport angeht.
Eine positive Nachricht zum Schluss: Ich bin auf meiner Reise schon Millionär geworden! Nein, es sind keine Gewinne an der Börse oder bei anderen Glücksspielen, die mir diesen Titel eingetragen haben. Ich habe schlicht und einfach einige tausend ungarische Forint in rumänische Lei getauscht und schon bin ich Millionär. Ich reise nun mit zwei 500'000-Lei-Scheinen nach Constanta und werde hoffentlich gebührend empfangen.
Die ganze Währungsumrechnerei wird sowieso immer schwieriger. Gelobt sei der Euro, denn zum Franken rund 50% dazu rechnen ist nicht so schwierig.
In Ungarn wird's schon ein bisschen komplizierter: Für einen Franken kriege ich rund 160 Forint oder sogar gut 250 für einen Euro. Um jetzt noch in Lei umzurechnen, greife ich grosszügig zur Rundungsschere, denn wie will ich in Franken wissen, was wie viel es kostet, wenn ich für 0.85 Forint 100 Lei erhalte? Also, her mit dem Dreisatz, ich habe ja sonst nicht zu rechnen. Für einen Forint kriege ich 100 Lei; 1 Forint kostet mich 1/160CHF; somit entsprechen 16'000 Lei dem Gegenwert von 1CHF.
Stimmt's?
Tja, für irgend öppis bin i ja vier Jahr a de ETH gsi...
29. Juli 2003
Istanbul (Türkei)
"...dann nehm' ich halt den Bus!"
Nach der sehr komfortablen Zugfahrt von Budapest nach Constanta bin ich zusammen mit dem Tschechen Pavel (der auch in Budapest mittrainiert hat und nun in die Ukraine und nach Russland fahren will) als erstes an den Hafen gefahren, um dort herauszufinden, ob, und wenn ja, wann die nächste Fähre nach Batumi respektive Odessa, Pavels Ziel in der Ukraine, fährt.
Doch wie schon in Budapest wurde bereits die 'Ob-Frage' negativ beantwortet. Ein zuvorkommender und glücklicherweise englisch sprechender Hafenbeamter teilte uns mit, dass es zur Zeit absolut überhaupt gar keine Personentransporte von Constanta aus auf dem Schwarzen Meer gibt. Und die Frachtschiffe lassen (wer hätte das gedacht...) nur Crewmitglieder und Transporteure mitreisen. Und da alles noch so heftige und ungläubige Staunen von unserer Seite kein Passagierschiff an den Hafen zauberte, zogen wir ernüchtert ab und suchten den Busbahnhof, wo aus wir uns Informationen zur Weiterfahrt versprachen.
Meine "Drohung", dass ich mich in Zukunft an Hauptreiseziele halten will und dass nicht dieser Kategorie angehörige Orte und Länder nicht weiter beachtet werden, wurde bereits in Constanta wahr gemacht.
Als wir auf den Busbahnhof zumarschierten, sahen wir schon von weitem einen gerade abfahrenden Bus. "Da steht ja Istanbul drauf", sage ich zu Pavel.  Istanbul, das wusste ich aus Reiseberichten, ist meine nächste Chance, denn von der Stadt am Bosporus sollte es ganz sicher eine Fähre nach Georgien geben. "Wenn Du Dich beeilst, erwischt du den Bus vielleicht noch!" ermuntert mich Pavel. Und tatsächlich, gegen genau 1 Million Lei konnte ich eine Fahrkarte erstehen und quasi auf den fahrenden Bus aufspringen. Pavel winkte mir zum Abschied und ich liess mich erleichtert und ein bisschen überrumpelt in den Bussessel fallen, lächelnd den Kopf schüttelnd ob diesem Zufall und der Tatsache, dass ich nun schon nicht mehr Millionär war.
Istanbul, das wusste ich aus Reiseberichten, ist meine nächste Chance, denn von der Stadt am Bosporus sollte es ganz sicher eine Fähre nach Georgien geben. "Wenn Du Dich beeilst, erwischt du den Bus vielleicht noch!" ermuntert mich Pavel. Und tatsächlich, gegen genau 1 Million Lei konnte ich eine Fahrkarte erstehen und quasi auf den fahrenden Bus aufspringen. Pavel winkte mir zum Abschied und ich liess mich erleichtert und ein bisschen überrumpelt in den Bussessel fallen, lächelnd den Kopf schüttelnd ob diesem Zufall und der Tatsache, dass ich nun schon nicht mehr Millionär war.
Die distanzmässig kurze Reise in die Türkei - nach Wien schon das zweite Tor zum Osten - dauerte wegen den diversen Grenzkontrollen (ROM out, BUL in, BUL out, TUR in) insgesamt rund 16 Stunden. Die Reise wäre wohl ohne die zwar langwierigen aber irgendwie trotzdem oberflächlichen Grenzkontrollen vier Stunden kürzer gewesen.
Oberflächlich deshalb, weil die Busbesatzung als offensichtlich routiniertes und eingespieltes Team ohne grössere Probleme liter- und kiloweise Hochprozentiges respektive Krebserregendes über die diversen Grenzen schmuggeln konnte. Diese Schmuggelaktivitäten haben weitere Stunden gedauert, denn bis das wertvolle Gut jeweils hinter der hintersten Sitzreihe (wo ich gesessen bin) versteckt und nach erfolgreich überstandener Grenzkontrolle wieder hervorgeholt wurde, verging sehr viel Zeit. Irgendwie belustigend. Aber auch bemühend, wenn das ganze Prozedere nach über zehn Stunden Fahrt morgens um 03.00 Uhr durchgeführt wird.
Entgegen meiner Erwartung hat mich Istanbul ruhig, beschaulich, geradezu provinziell empfangen und nicht etwa hektisch und chaotisch, wie ich es erwartet hatte.
Ich bin ja so unvorbereitet wie irgendwie möglich in Istanbul angekommen, denn Istanbul und die Türkei sollten ja "umschifft" werden. Doch natürlich lasse ich mir die unverhoffte Chance nicht entgehen, zumindest eine Nase voll von dieser pulsierenden Millionenstadt zu erhaschen, indem ich die oben angedeutete "Hauptreiseziel-Regel" schon bei der ersten Gelegenheit ein bisschen aufweiche.
Wie viel habe ich schon gehört von dieser Stadt, die sich rühmt, die einzige Stadt zu sein, die auf zwei Kontinenten erbaut wurde. Istanbul und seine Menschen präsentierten sich mir so vielfältig, wie es nur eine Millionenstadt mit einer langen und bewegten Geschichte und den diversesten Einflüssen tun kann.
Ich habe freundliche und hilfsbereite, zuvorkommende und stolze, laute und demütige, ängstliche und vorsichtige, mitteilsame und übervorteilende, ehrliche und offene und viele lächelnde Menschen gesehen und getroffen.
Als Konklusion aus meinem kurzen Istanbul-Aufenthalt halte ich fest, dass es für mich sehr schwierig ist, die Stadt richtig einzuschätzen, da mir der kulturelle und sprachliche Hintergrund und somit auch der wirkliche Zugang zu den Menschen fehlen. Aus meinen ersten Eindrücken muss ich leider sagen, dass ich keine einzige Begegnung mit Menschen hatte, die ich (oder besser natürlich: die mich!) auf der Strasse kennen gelernt hatte/n, die länger als drei Minuten gedauert hat und dann nicht darauf hinauslief, dass ich diesen Menschen etwas abkaufen oder einfach sonst Geld geben sollte.
Diese Erfahrungen hinterlassen neben all den guten Begegnungen und Erlebnissen einen etwas schalen Nachgeschmack. Wahrscheinlich hätte ich bei einem längeren Aufenthalt besser damit umzugehen gelernt.
Der kurze Aufenthalt in Istanbul hat sich trotzdem gelohnt, doch natürlich zieht es mich vor allem weiter, ich will endlich Georgien erreichen und dort versuchen, ein Gefühl für dieses Land zu erhalten.
Die beste Einstimmung auf Georgien wäre sicherlich eine Anreise per Schiff gewesen; so hätte ich genügend Zeit und Bewegungsfreiheit gehabt, mir Gedanken zu machen, mich vorzubereiten und durch weitere Lektüre einzustimmen.
Diesmal schreibe ich nicht lang um den heissen Brei herum und mache es kurz. Natürlich auch hier in Istanbul: Kein Personenschiff weit und breit. Kein einziger Ort an der ganzen türkischen Schwarzmeerküste wird von Istanbul aus per Schiff bedient, ganz zu schweigen natürlich von Georgien. Nur Pavel hätte hier Glück gehabt, Odessa wird auf dem Schiff von Istanbul aus angefahren.
Darum nehme ich heute Abend den Bus und der kostet mich glatte 42 Millionen!
Das ist aber nicht weiter schlimm, denn ich bin inzwischen wieder Millionär geworden, türkische Lira-Millionär. Die Fahrt kostet umgerechnet rund 40 CHF und sollte etwas mehr als 24 Stunden dauern. Dabei soll eine Strecke zurückgelegt werden, die gut und gern zwei bis drei Mal so Lang ist wie die von Constanta nach Istanbul.
Georgien, ich komme! Ausser natürlich, mein Bus wird von einem Schiff gerammt...
27. August 2003
Tiblissi (Georgien)
"In Georgien, Flaschen werden niemals leer!"
Georgien ist Gottes Land. So jedenfalls will es die Legende, die gerne und oft zitiert wird (Georgien-Kenner clicken 'Skip Intro'...).
"Als Gott dabei war, die Ländereien der Erde an die verschiedenen Völker zu verteilten, kamen die Georgier zu spät. So spät, dass alles Land bereits verteilt war. Die Georgier entschuldigten ihre Verspätung damit, dass sie bei einem grossen Festessen waren und immer wieder auf die Gesundheit und das Heil von Gott angestossen hatten. Gott war geschmeichelt ob so viel Ehrerbietung und entschloss sich kurzerhand, den Georgiern das besonders schöne Stück Land zuzusprechen, das er eigentlich für sich behalten wollte.
Und deshalb ist Georgien nichts anderes als eben Gottes Land."
Das Land und die Leute
Wie häufig sind Legenden dazu da, eine nicht immer allen Wünschen entsprechende Gegenwart in ein glänzenderes Licht zu tauchen.
Dass Georgien Gottes Land ist, das würde man gerne glauben, wenn da nicht all die Zeichen von Verfall wären, all die traurig anzuschauenden Relikte aus der Zeit, als Georgien noch eines der reichsten Gebiete innerhalb der Sowjetunion war.
Zu dieser Zeit, also vor nicht einmal zwanzig Jahren, gab es für viele Sowjetbürger nichts Schöneres, als an den traumhaften Stränden des Schwarzen Meers im Westen, in den ausgedehnten Weintälern im Osten oder in der prächtigen, erfrischenden Bergwelt im Norden Georgiens Ferien zu machen. Investitionen wurden getätigt, der Rubel floss in Strömen aus Moskau in den Südkaukasus. Die Georgier hatten ein sicheres, gutes Einkommen und so wurden breite Strassen angelegt, prächtige Hotels, ausgedehnte Fabrikanlagen und stattliche Landsitze errichtet.
Doch seither ist viel Wasser den Rioni hinuntergeflossen. Die Zeiten haben sich geändert und die einst prächtigen Strassen sind mit Schlaglöchern übersät, die Hotels sind einsturzgefährdet und meistens mit Flüchtlingen aus dem Krisengebiet Abchasien dauerbelegt, die Fabriken nicht mehr in Betrieb und die Wohnhäuser renovationsbedürftig.
Georgien wird von sehr gastfreundlichen Menschen bewohnt, die trotz all den offensichtlichen Zeichen der schweren Krise mit dem Gast das Wenige das sie haben gerne und grosszügig teilen. Der Besucher spürt fast auf Schritt und Tritt die grosse Vergangenheit dieses Landes, spürt, wie die Bewohnerinnen und Bewohner sich wie in einem schlechten und dafür umso länger anhaltenden Traum zu befinden glauben und sehnlichst hoffen, bald wieder aufzuwachen. Wieder aufzuwachen um zu sehen, dass alles wieder so ist wie es einmal war, in der guten alten Zeit.
Am liebsten möchte ich sie schütteln und ihnen zurufen: "Wenn ihr nichts unternehmt, dann wird auch nichts passieren! Wenn ihr nicht versucht, diese schwere Krise selbst mit aller Kraft zu bewältigen und das Land einer besseren Zukunft zuzuführen, dann wird sich ganz sicher nichts ändern!"
Doch natürlich weiss ich im gleichen Moment, dass dies nur die Gedanken eines verwöhnten und noch nie eine ernsthafte Krise durchlebt habenden Westbürgers sind. Eines verwöhnten Menschen, der nicht weiss, was es bedeutet, wenn man am Monatsende nicht sicher ist, ob die versprochenen (umgerechnet) 30 CHF Monatslohn auch wirklich überwiesen werden. Eines Menschen, der nicht weiss, wie es sich anfühlt, wenn man schon viel verloren und scheinbar nichts mehr zu gewinnen hat. Eines Menschen, der nicht weiss, wie es sich anfühlt, wenn man machtlos zusehen muss, wie sich Teile der Regierung auf Kosten der darbenden Bevölkerung bereichern.
Die Resignation der Generation der über 40-Jährigen ist verständlich. Doch das nimmt ihr nichts vom Schrecken und der Hoffnungslosigkeit, die sich auf den diesem Desaster ebenso hilflose ausgelieferten Gast direkt überträgt.
Natürlich und zum Glück gibt es neben den traurigen Zeichen der grauen Gegenwart auch zarte Hoffnungsschimmer: Durch die Massen der meist träge am Strassenrand sitzenden Nachkriegsgeneration laufen beschwingten Schrittes immer wieder junge, initiative Leute, die die Geschichte nur aus der Schule kennen und sich nicht darum kümmern, wie schön es einmal war, sondern nur daran interessiert sind, Wege zu finden, damit die Zukunft eine lebenswertere wird. Leider sind solche Menschen momentan noch in der Minderheit und müssen für ihre Anliegen nicht nur gegen die starre und oft korrupte Regierung, sondern auch gegen die Lethargie ihrer Mitbürger kämpfen.
Doch - die Zeit wird zeigen, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege - das Land hat ein grosses Potenzial und wird in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren hoffentlich eine sehr positive Entwicklung erleben.
Umso schöner und wertvoller sind dann die Momente der Fröhlichkeit und Ausgelassenheit, die Stunden der Geselligkeit, wo alle Sorgen vergessen werden, wo gegessen und getrunken, geschwatzt und gefeiert wird, als ob es kein Morgen gäbe. Denn dann weiss man sich wirklich in Gottes Land: Die Tafel ist übervoll gedeckt mit allem was die Natur zu bieten hat - und sie hat vieles zu bieten. Nicht zuletzt wegen der schier unglaublichen Fruchtbarkeit des Bodens und des optimalen Klimas für jedwelches Gewächs können viele Georgier überhaupt gut und gesund überleben.
Selbstversorgung heisst die Lösung: Jeder Baum oder Strauch scheint Früchte zu tragen, die gegessen, eingemacht, zu Saucen oder Saft verarbeitet werden können. Die Tomaten und Gurken gedeihen wie es scheint überall in rauen Mengen und schmecken, wie wenn sie ein glückliches Leben gehabt hätten.
Genau gleich steht es um alle Fleischprodukte: Schweine und Kühe kreuzen die Strassen und bewegen sich so frei wie sie nur wollen. Das Fleisch ist meist so frisch, dass man zu wissen glaubt, dass das Tier gestern noch auf den satten Wiesen herumgelaufen ist.
Es gibt wohl nicht viel georgischeres in Georgien, als von Einheimischen an eine Tafel gebeten zu werden, um dabei neben dem schlicht grossartigen Essen auch die traditionelle und berühmte Trinkzeremonie miterleben zu dürfen.
Einige Male hatte ich das Glück, bei solchen Festivitäten dabei zu sein.
Das letzte Mal sind wir eher unerwartet bei einer Gastfamilie eines Kollegen eingetroffen. Um keinen unnötigen Aufwand zu bereiten, boten wir dem Hausherrn an, auswärts essen zu gehen. Der entgeisterte Blick des stattlichen Herrn sagte schon alles, so dass die Übersetzung seiner Aussage etwa wie folgt tönte: "In unserem Haus wird über solche Dinge nicht gesprochen!", und nur zu gut ins Bild des georgischen Gastgebers passte.
Also sind wir zusammen auf den Basar gefahren, um die benötigten Produkte einzukaufen. Allein schon ein Besuch auf einem Basar ist für mich jedes Mal wieder ein Erlebnis: Die Produkte sehen so frisch und natürlich aus und werden meist so schön ausgestellt, man könnte meinen, man befinde sich in der Globus Delicatessa. Mit dem offensichtlichen Unterschied, dass die Produkte hier nicht verpackt sind und keine weite Reise hinter sich haben.
Die Trinkzeremonie läuft jeweils so ab, dass der Tamada, also der höchste, wichtigste und interessanteste Herr am Tisch (das muss nicht zwingend der Hausherr sein, doch, so viel ich weiss muss es ein Herr sein...) jeweils zu einem Trinkspruch anhebt, bevor angestossen und das Glas mit dem Wein oder Schnaps in einem Zug geleert wird.
Typische Themen für Trinksprüche sind zum Beispiel, dass auf den Frieden, auf die Eltern und Kinder, auf die Verstorbenen, auf die Freundschaft oder auf die Heimatländer der Anwesenden angestossen wird.
Je länger die Tafel aufrecht erhalten wird, desto länger werden die Trinksprüche. Und wenn der Tamada selber betrunkener wird kann es vorkommen, dass der eine oder andere Trinkspruch wiederholt wird.
Was aber ganz sicher nicht vorkommt, ist dass es nicht genug Wein oder Schnaps auf dem Tisch hat. Denn immer wieder werden neue und meist grössere Flaschen aus dem Vorratsraum gezaubert, um die Karaffe wieder aufzufüllen.
Dazu kann ich nur sagen: "Gaumardschoss, Skartwelo!", was so viel heisst wie: "Auf Dein Wohl, Georgien!"
Die Sprache
Tja, die Sprache... Einer der Hauptgründe, wieso ich so lange damit zugewartet habe, dem Osten - von der Schweiz aus gesehen wenigstens ist es der Osten - einen längeren Besuch abzustatten, war die Tatsache, dass ich keine "Ost-Sprache" spreche.
Ich wusste, dass die Verständigung schwierig werden würde. Denn ich spreche weder Russisch noch Ungarisch oder Türkisch, von Georgisch ganz zu schweigen. Dass ich auch kein Chinesisch spreche, wird mich zu einem späteren Zeitpunkt noch beschäftigen...
Mit dem Georgischen ist es so eine Sache. Was da gesprochen wird, kommt mir nämlich ganz und gar nicht spanisch vor. Und auch nicht italienisch oder französisch, was nichts anderes bedeutet, als dass es ziemlich schwierig ist, auch nur im Entferntesten erraten zu können, was da gesprochen wird.
Und geschrieben wird auch alles ziemlich anders. Die Georgier haben ein total eigenes, schön anzuschauendes Alphabet mit aktuell 33 verwendeten Zeichen (ich wenigstens würde diese verschnörkelten Gebilde eher als Zeichen denn als Buchstaben bezeichnen).
Damit ich mit den Einheimischen anders als nur mit rudernden Armbewegungen und pantomimischen Verrenkungen kommunizieren kann, hatte ich mir tapfer vorgenommen, mir bei meiner Ankunft in Batumi an der georgischen Schwarzmeerküste in einigen Tagen das Alphabet und einige Basis-Sprachkenntnisse anzueignen.
Doch dieses Ansinnen wurde von der Tatsache vereitelt, dass ich in eine Gruppe von Peace Corps Volunteers (Details unter "Die Nichtregierungsorganisation Peace Corps") gelaufen bin (oder sie in mich) und ich mich ab dann vor allem Englisch unterhalten habe.
Natürlich wollte und musste ich trotzdem ein paar Brocken Georgisch lernen, denn abseits von Tbilisi waren die der englischen oder deutschen Sprache mächtigen Menschen sehr selten. Mit dem mitgebrachten Wörterbuch konnte ich mir auch einige Kenntnisse aneignen, doch eine Sprache allein durch Auswendiglernen von einigen Sätzen und Wörtern lernen zu wollen, das ist schon nicht so das Wahre. Und da die Georgier nicht nur bei der Verteilung des Landes, sondern scheinbar auch bei der Verteilung der Vokale zu spät gekommen sind, macht mir die Sprache nochmals zusätzliche Schwierigkeiten.
Ein paar Kostproben gefällig? Da ich wie schon erwähnt die georgischen Zeichen nur rudimentär lesen und schreiben kann und ich den PC-Prozessoren keine unnötige Arbeit machen möchte, verwende ich für die nachfolgenden Beispiele die phonetische Schreibweise.
Die Frage: "Wie alt sind sie?", tönt so etwa wie "ramdeni zliss brdsandebit?" Auf die Frage: "Wie geht es dir?" ("Rogora char?") kann man höflich mit: "gmadlobt, kargad da tkwen?" ("Danke, gut, und ihnen?") antworten. Das Zählen wird dem Ausländer auch nicht sonderlich leicht gemacht. Es genügte nicht, dass ich mir die Bezeichnungen für die Zahlen an sich schon schlecht merken konnte, nein, im Georgischen wird auch noch ein auf der Basis von zwanzig aufbauendes System verwendet. Drei heisst "ssami", zehn tönt wie "ati", elf heisst "tertmeti", 20 heisst "ozi". 30 heisst dann "ozdaati", also zwanzigundzehn. Wie heisst demnach wohl 71 auf georgisch? Richtig, drei-mal-zwanzig-und-elf, also "ssamozdatertmeti".
Doch, und das ist das Schöne am Georgisch-Lernen, meistens kommen die Georgier nicht aus dem Staunen heraus und sind sehr dankbar, wenn man als Tourist nur schon ein paar Brocken ihrer alten, ehrwürdigen Sprache zu sprechen versucht. Sie sind dann auch sehr gerne dazu bereit, geduldig zu warten, bis man wieder einen Satz zusammen hat, um dann gemeinsam (natürlich hat sich bereits eine Menschentraube um den Fremdling gebildet) herauszufinden, was der komische Tourist nun wieder hat sagen wollen.
Die Nichtregierungsorganisation 'Peace Corps'
Mein rund vierwöchiger Georgien-Aufenthalt wäre ganz sicher anders und sehr wahrscheinlich viel weniger spannend, weniger aufschlussreich und weniger "nah am Geschehen" ausgefallen, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, dass ich zum Zeitpunkt der Schulferien in Georgien angekommen wäre. In den Schulferien haben auch die Lehrer frei und rund 40 Lehrer in Georgien gehören dem Peace Corps (PC) an, einer amerikanischen Entwicklungsorganisation, die in fast 80 Ländern tätig ist und neben anderen Tätigkeiten vor allem die lokalen Lehrkräfte beim Englisch-Unterricht unterstützen.
Schon auf dem Weg von Istanbul nach Batumi habe ich das erste PC-Mitglied getroffen und dann in Batumi selber, meiner ersten Station in Georgien, eine ganze Gruppe. Von da an war ich in guten Händen und wurde mehr oder weniger von Dorf zu Dorf weitergereicht, da die PC-Freiwilligen meist abseits der grossen Städte tätig sind. Auf diese Weise erhielt ich einen Einblick in das georgische Landleben, wie es sonst wohl nur mit viel Glück möglich gewesen wäre.
Die in der Regel 20- bis 30-jährigen Freiwilligen  (hier im Bild die Peace Corps Volunteers David, Tina, Jonathan) leisten einen rund zweijährigen Dienst abseits der Heimat. Für viele ist es die erste Reise über den grossen Teich.
(hier im Bild die Peace Corps Volunteers David, Tina, Jonathan) leisten einen rund zweijährigen Dienst abseits der Heimat. Für viele ist es die erste Reise über den grossen Teich.
Diesen Leuten gehört meine ganze Bewunderung, nicht zuletzt nachdem ich mit ihnen ausführlich gesprochen und ihre Motive erfahren habe. Hauptsächlich wurde folgendes genannt: "Ich will für einmal wirklich vor Ort sein und wissen, was es bedeutet, wenn irgendwelche Nachrichtensender irgendwelche Nachrichten senden, von denen ich nicht weiss, was ich glauben kann und was nicht. Ich will mir selbst meine Meinung bilden und meine eigenen Erfahrungen sammeln, ungefiltert, unzensuriert. Und wenn ich noch Unterstützung leisten kann und meine Hilfe ein Fortschritt für einige Personen bedeutet, umso besser."
Reich werden ist nämlich ganz sicher nicht ihr Motiv: Der Lohn ist mit rund 100 Lari, also ca. 55 US$ pro Monat sehr knapp bemessen, doch sie alle haben schon Erfahrungen gemacht, die ihr Leben verändern werden.
Ihre Aufgabe ist es, in den Schulen, die sich für eine Unterstützung beworben haben, den Englisch-Unterricht zu unterstützen und daneben weitere Initiativen zu ergreifen oder Organisationen zu unterstützen. Typische Aktivitäten sind zum Beispiel die Hilfe beim Aufbau von regionalen Umweltschutzorganisationen oder diverse Hilfestellungen zur lokalen Entwicklung, so dass das Dorf zum Beispiel einen Internetzugang erhält.
Transportieren
Das magische Wort heisst "Marschrutka" und, mindestens so wichtig, "gaatscheret". Marschrutkas sind die allgegenwärtigen Kleinbusse, welche die Städte und auch das ganze Land via die Strassen (also das wenige Flache neben den Schlaglöchern, das würde man bei uns Strasse nennen...;-) ) erschliessen. Die Kleinbusse haben regulär zwischen zehn und 15 Sitzplätzen (verlässliche Quellen berichten aber, dass auch 27 Personen damit transportiert werden können) und sind meistens ausrangierte Firmenbusse von Deutschen Firmen.
Das ist unschwer zu erkennen, denn die Beschriftung ist, wo noch kein Lackschaden aufgetreten ist, nicht entfernt worden. So grüssen "Media Markt", "Spenglermeister Kernich" aus Wuppertal und die "Papierfabrik Scheufelen" aus Oberlenningen auf den georgischen Strassen.
Die Marschrutkas nennt man auch Sammeltaxis. Das System ist eine intelligente Kombination zwischen Taxi und Bus. Die Wagen sind mit einer Nummer (innerhalb einer Stadt) und mit den Strassen- oder Ortsnamen (siehe "Die Sprache"...) angeschrieben und befahren immer die gleiche Strecke. Auf dieser Strecke kann man ein- und aussteigen wann immer man will. Ein deutliches "gaatscheret" (was soviel wie "anhalten, bitte" bedeutet) lässt den Fahrer am Strassenrand anhalten. Bevor man aussteigt wird noch der Obolus entrichtet, was den mit dem Zustieg stillschweigend eingegangenen Vertrag abschliesst. Eine Fahrt kostet je nach Stadt zwischen 20 und 50 Tetri, also ca. 15 bis 30 Rappen.
In den dicht befahrenen Gebieten steht es um die Atemluft nicht zum Besten, was durch die Tatsache zu erklären ist, dass die Gefährte auf Langlebigkeit getrimmt werden. Russische Fahrzeuge aller Altersklassen und - wie schon erwähnt - ausrangierte Fahrzeuge aus dem Westen dominieren den vierrädrigen Verkehr.
Dass man angesichts des Zustands der Strassen und Autos nicht mindestens alle fünf Minuten einen Unfall mit wenigstens einem Blechschaden sieht, ist eigentlich erstaunlich. Der Verkehr verläuft meist flüssig, laut und stinkend. Es herrscht ein organisiertes Chaos, in dem alle Verkehrsteilnehmenden die stillschweigend vereinbarten und durch langes Training erlernten Regeln genau einzuhalten scheinen: Überholt wird zu fast jedem Zeitpunkt, denn schliesslich kann ja das entgegenkommende Fahrzeug auch ein bisschen ausweichen. Ist nicht eine normale zweispurige Strasse überall auf der Welt genug breit für drei Fahrzeuge? Der Blinker wird grundsätzlich nicht eingesetzt, wobei nicht ganz klar ist, ob er überhaupt funktionieren würde.
Fussgänger haben ein hartes Leben und sind hier definitiv die schwächsten Verkehrsteilnehmen, auf die nur im äussersten Notfall Rücksicht genommen wird.
Ab und zu kommt es vor, dass man auf eines der zahlreichen in der Stadt herumkurvenden Taksis angewiesen ist. Da Zeit billig und Benzin teuer ist, beginnt eine längere Taxifahrt meistens mit einer Fahrt zur Tankstelle, wo in den meist fast leeren Tank ziemlich genau soviel Benzin eingefüllt wird, wie es für die geplante Reise brauchen wird. Dabei ist mit einberechnet, dass schon bei der kleinsten Hügelabfahrt der Motor abgestellt wird, um ein paar weitere Tropfen Benzin zu sparen.
Geschichtliches
Die ältere und jüngere Geschichte von Georgien beziehungsweise dem Gebiet des heutigen Georgien ist so vielfältig, so spannend, abwechslungsreich und interessant, dass ich davon ganz sicher keinen umfassenden Überblick in diesem Blog schildern kann.
Dazu gibt es einschlägige Bücher und Websites, die das viel korrekter und übersichtlicher darstellen. Ich werde einzig ein paar Details herauspicken, die irgendwie im Zusammenhang mit meiner Reise gestanden sind.
Georgien hat dank oder auch halt eher wegen seiner speziellen Lage zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer schon vor rund 3'000 Jahren eine grosse Bedeutung als strategisch wichtige Region eingenommen. Und deshalb war dieses Gebiet immer wieder umkämpft und der Eroberungswut des gerade mächtigsten Herrschers der Region ausgeliefert.
Viele Sprachen wurden in diesem Gebiet schon gesprochen, vielen Königen gedient, zu vielen Göttern gebetet. Allein Tbilisi wurde in den 1'500 Jahren seit der Gründung rund 30 Mal eingenommen, zumindest teilweise zerstört und wieder aufgebaut. Doch die Stadt hat überlebt und strahlt eine grosse Faszination aus, die schon die Legende der Gründung belegt:
"Der damalige georgische König Wachtang Gorgasali war im Jahr 458 auf der Jagd und erlegte mit gezieltem Bogenschuss einen Fasan. Der Vogel fiel in eine Quelle, die so heiss gewesen sein soll, dass er bereits tischfertig gegart war, als ihn des Königs Mannen Minuten später aus dem Tümpel bargen. Wachtang stellte fest, dass es hier noch weitere warme Quellen gab, und liess sofort eine Stadt gründen, die er zur neuen Hauptstadt Georgiens machte. Noch heute verweist ihr Name Tbilisi (tbili=warm) auf diesem Reichtum." (Zitiert aus: Kaukasus, Rainer Kaufmann, Prestel Verlag, 2000)
Stadt der warmen Quellen, so heisst die Stadt an der Kura noch immer. Ein Besuch in einem der wenigen funktionierenden Schwefelbäder im Bäderviertel Abanotubani ist eine tolle Sache, nicht zuletzt, wenn man das Wohlfühlerlebnis mit den freundlich angebotenen Massagen abrundet. Von den einst rund 60 Schwefelbädern sind momentan nur einige wenige in Betrieb. Doch nach und nach werden weitere Bäder wiedereröffnet, was diesen sowieso schon attraktiven Teil der Stadt weiter aufwerten wird.
Ein Besuch in einem der grossen Museen der Stadt wurde zum praktischen Beispiel erlebter Geschichte. Ich besichtigte unter sachkundiger Führung die Schatzkammer im Historischen Museum von Tbilisi. Dort wurden Schmuck und Münzen, Waffen und kultische Gegenstände ausgestellt. Erstere vor allem als Grabbeigaben von Königen und Prinzessinnen, reichen Bürgerinnen oder hohen Beamten. Die prächtigen Ausstellungsobjekte lassen den Besucher staunen. Die Schmuckstücke sind so filigran gearbeitet und von solch hoher künstlerischer Qualität, dass man sich unvermittelt vorzustellen versucht, wie es wohl bei einem Künstler oder Goldschmied vor 2'000 Jahren ausgesehen hat.
Der Rest des riesigen Museums mit anscheinend herausragenden archäologischen und ethnografischen Ausstellungsräumen bleibt dem interessierten Besucher leider verschlossen. Das staatlich geführte Museum ist nicht in der Lage, die laufenden Stromrechnungen zu bezahlen. Inzwischen beläuft sich die Schuld gegenüber dem Elektrizitätswerk auf umgerechnet rund 6'000 CHF. "Bevor diese hohe Summe nicht bezahlt wird, wird es nicht möglich sein, den Rest des Museums zu besichtigen. So lange werden die Räume im Dunklen bleiben. Und dass diese Schuld bald beglichen wird, ist sehr unwahrscheinlich", so sichtlich resigniert die studierte Museumsangestellte.
Vermischtes
Oft sieht man einzelne Personen oder ganze Gruppen von Männern, die in einer scheinbar bequemen Kauerstellung verweilen, sei's diskutierend, rauchend oder einfach nur die Gegend beobachtend. Diese Stellung - beide Füsse von den Zehen bis zur Ferse am Boden, die Knie so stark gebeugt, dass das Gesäss beinahe den Boden berührt - ist vielen westlichen, nicht speziell trainierten Erdenbürgern alles andere als bequem, wenn nicht sogar unmöglich einzunehmen, ohne nach hinten auf den Rücken zu kippen. Und tatsächlich ist es jahrelanges Training, das die Männer diese Übung so perfekt demonstrieren lässt, handelt es sich doch um nichts anderes als die erwiesenermassen bequemste Stellung, um auf einem ebenerdig angelegten und in Georgien weit verbreiteten Plumpsklo seine Notdurft zu verrichten.
Ein Typ von Massage, der in den Schwefelbädern von Tbilisi angeboten wird, ist eine mir bisher unbekannte Form von "Reibmassage". Der Masseur reibt mit einem sehr rauhen Handschuh so stark auf der Haut des Kunden, bis die berühmten "schwarzen Rugeli" haufenweise vom Körper fallen. Stolz weist der Masseur dann auf die Produkte seiner Arbeit hin und der Kunde fühlt sich wirklich leichter, sauberer als zuvor. Wie hoch der Anteil der Autoabgase in den schwarzen Hautrugeli war, konnte ich nur vermuten.
Die Stationen
Für die ganz Interessierten, die auf einer Landkarte die Orte suchen wollen, an denen ich vorbeigekommen bin, zähle ich in der Folge auf, wo mich meine Reise in Georgien in etwa durchgeführt hatte: Meine erste Station in Georgien war, wie schon erwähnte, das verträumte und mich irgendwie an ein Städtchen am Mittelmeer erinnernde Batumi ganz im Südwesten, 20 km nördlich der türkischen Grenze. Von Batumi ging's weiter nach Kutaisi. Kutaisi ist mit rund 250'000 Einwohnern die zweitgrösste und mir leider unsympathischste Stadt Georgiens. Das düster-traurige Klima verdankt die Stadt wohl vor allem einer weit über dem Landesdurchschnitt liegenden Arbeitslosigkeits-Quote.
Dann in die Berge von Racha nach Ambrolauri, wo ich dank den PC-Volunteers Tina und David einen abenteuerlichen Ausflug zu Pferde unternehmen konnte.
Darauf wieder zurück in die Nähe von Kutaisi nach Samtredia, von wo aus ich dann nach Tbilisi weiterreiste. Tbilisi ist Georgiens Megacity, wo fast ein Drittel der Einwohner leben.
Von Tbilisi aus unternahm ich dann mehrere Ein- oder Mehrtagesausflüge zum Beispiel nach Gori, der Geburtsstadt von Stalin (nicht nur dort wird er noch von vielen Menschen verehrt); in die alte Hauptstadt Mzcheta; auf der militärischen Heerstrasse Richtung Russland bis nach Kazbegi mit dem Highlight  Zminda Sameba vor dem über 5'000m hohen Kazbeg (siehe Abbildung); in das Wüstenkloster David Gareja, nahe an der Grenze zu Aserbaidschan und schliesslich nach Borjomi (Heimat des berühmtesten georgischen Mineralwassers) und Akhaltsikhe, wenige Kilometer von der türkischen respektive armenischen Grenze entfernt.
Zminda Sameba vor dem über 5'000m hohen Kazbeg (siehe Abbildung); in das Wüstenkloster David Gareja, nahe an der Grenze zu Aserbaidschan und schliesslich nach Borjomi (Heimat des berühmtesten georgischen Mineralwassers) und Akhaltsikhe, wenige Kilometer von der türkischen respektive armenischen Grenze entfernt.
Mein bisher längster Aufenthalt in einem Land war - soviel steht jetzt schon fest - ein herausragendes Erlebnis. Im Kleinen war es so etwas wie eine Reise in eine andere Welt, die sich ganz sicher zu besuchen lohnt; und das nicht mal drei Flugstunden - falls man nicht über Land reisen kann oder will - von Wien entfernt.
Morgen nehme ich für rund zehn Lari (knapp sechs CHF) die etwa sechsstündige Marschrutka-Fahrt via Langodeki nach Scheki in Angriff, meiner ersten und wie ich gelesen habe sehr charmanten Station in Aserbaidschan.
8. September 2003
Baku (Aserbaidschan)
Aserbaidschan, Land aus Öl und Sand
Ist natürlich gelogen oder wenigstens arg übertrieben, das mit dem Öl und Sand, denn das grösste der drei südkaukasischen Länder hat weit mehr zu bieten als nur öde Wüsten und von der Erdölförderung verwüstet Landstriche. Aber dafür ist es ein griffiger Titel geworden, oder nicht?
Wie früher die Kamele
Um auf dem Landweg von der georgischen Hauptstadt Tbilisi in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku zu gelangen, ist es gemäss diversen Reiseführern empfehlenswert - falls man nicht in Eile ist - anstatt der schnelleren Südroute, welche vor allem durch eine öde und eintönige Wüstenlandschaft führt, die langsamere Nordroute via Scheki zu wählen.
Selbstverständlich habe ich die Nordroute gewählt, denn schliesslich will ich ja dem grossen Robert Walser nacheifern, der bereits Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts gesagt haben soll: "Ich bin überzeugt, dass wir viel zu wenig langsam sind."
Die Nordroute nach Aserbaidschan führt von Tbilisi aus durch das für seine Weine bekannte Gebiet Kachetien. Hunderte von Traubensorten sollen in diesem östlichsten Zipfel Georgiens wachsen. Aus dem Fenster der Marschrutka, die nach einem gemächlichen Start - zu Beginn der Fahrt musste natürlich noch getankt werden, der Fahrer erledigte noch die eine oder andere Besorgung und traf noch den einen oder anderen Kollegen, der ihm etwas mitgab, das er dann unterwegs abgeben sollte - dann schliesslich doch noch auf eine den Strassenverhältnissen angemessene Reisegeschwindigkeit beschleunigt hat, konnte ich dies natürlich nicht verifizieren.
Doch ich hatte mich innerlich ja auch schon von Georgien verabschiedet, so dass ich mehr gespannt und neugierig auf Aserbaidschan als traurig ob der verpassten Weinräusche war.
Die Grenze konnte ich trotz selbstverschuldeter Verzögerung relativ problemlos passieren. Die Verzögerung kam so zustande: Von anderen Reisenden wurde mir gesagt, dass ich bei diesem Grenzübertritt aufpassen müsse, dass ich wirklich einen Einreisestempel erhalte. So vorbereitet war ich nicht überrascht, als ich nach erledigter Passkontrolle den Einreisestempel nicht sofort finden konnte. Daraufhin verlangte ich von den Beamten vehement einen Einreisestempel, ohne den ich bei der späteren Ausreise mit Sicherheit Probleme bekommen würde. Aber erst nach längeren Hand-und-Fuss-Diskussionen merkte ich, dass der Stempel schon lange korrekt im Pass vorhanden war. Ein weiterer Beweis dafür, dass Vorsicht und gute Ratschläge manchmal auch hinderlich sein können...
Die verbleibenden zwei Fahrstunden bis zu meinem ersten Ziel, dem verträumten Bergstädtchen Scheki, verbrachte ich vor allem damit, mich über die kleinen aber feinen Unterschiede seit dem Grenzübertritt zu wundern.
Alles wirkt ein bisschen aufgeräumter, sauberer. Die Strassen haben weniger Schlaglöcher, die Strassenränder sind nicht vollständig mit Unrat übersät. Die Tankstellen sind wirklich als solche zu erkennen und die Angestellten tragen Uniformen, der Chef ein sauberes Hemd und Krawatte. An den Strassenränder stehen keine Kühe, dafür bis zum Kopf in Schlammlöcher abgetauchte Wasserbüffel.
In Scheki kommt dann das erste Mal so etwas wie ein "Seidenstrassen-Gefühl" auf, als ich ehrfürchtig in die Karavanserei eintrete, die natürlich zu einem richtigen Hotel ausgebaut wurde. Das wunderschöne Gebäude lädt zum Träumen über vergangene Zeiten ein, als Reisen noch ein Abenteuer war und die Natur oder Banditen die Reisegeschwindigkeit bestimmt haben.
Später erfahre ich, dass der im ausgehenden 18. Jahrhundert errichtete Prachtbau  (im Bild die Karavansaray in Scheki) seinen Betrieb erst nach dem Ende der eigentlichen Seidenstrasse aufgenommen und deshalb wohl niemals echten Karawanen Schutz geboten hat. Doch Reisende können sich in diesen kühlenden Gemäuern noch immer sehr gut erholen, so dass die Tage in Scheki wie im Fluge vergehen. Ich bleibe dann sogar länger als geplant, denn die Natur hat für einmal auch meine Reisegeschwindigkeit bestimmt. Eine in den Därmen hausende Reisekrankheit hält mich davon ab, die 6-Stunden-Busfahrt nach Baku am geplanten Tag zu wagen, so dass ich länger als geplant im beschaulichen Scheki verweile. Der längere Aufenthalt hatte auch sein Gutes. Ich konnte Zeuge eines Hochzeitsfestes werden, welches in einem Nachbargebäude stattfand. Die zwei Tage dauernde Festivität drehte sich um Speis und Trank, Musik und Tanz.
(im Bild die Karavansaray in Scheki) seinen Betrieb erst nach dem Ende der eigentlichen Seidenstrasse aufgenommen und deshalb wohl niemals echten Karawanen Schutz geboten hat. Doch Reisende können sich in diesen kühlenden Gemäuern noch immer sehr gut erholen, so dass die Tage in Scheki wie im Fluge vergehen. Ich bleibe dann sogar länger als geplant, denn die Natur hat für einmal auch meine Reisegeschwindigkeit bestimmt. Eine in den Därmen hausende Reisekrankheit hält mich davon ab, die 6-Stunden-Busfahrt nach Baku am geplanten Tag zu wagen, so dass ich länger als geplant im beschaulichen Scheki verweile. Der längere Aufenthalt hatte auch sein Gutes. Ich konnte Zeuge eines Hochzeitsfestes werden, welches in einem Nachbargebäude stattfand. Die zwei Tage dauernde Festivität drehte sich um Speis und Trank, Musik und Tanz.
“Baku, where the fire burns eternally...”
Baku, die Hauptstadt Aserbaidschans, war für rund eine Woche mein Ausgangspunkt für Tagesexkursionen in und um die 2-Millionen-Stadt, die ähnlich wie Tbilisi in Georgien etwa ein Drittel der Einwohner des Landes beheimatet.
Die sehenswerte Altstadt Bakus mit dem faszinierenden Jungfrauenturm (siehe Abbildung) und dem Schirwan-Schah-Palast, Gespräche mit geduldigen Teppichhändlern, das Ausprobieren von diversen Speisen, Besuche in Feuertempeln, wo früher die Feueranbeter des Zoroastrismus lebten (der gute alte Zarathustra sprach also nicht nur verschiedene Dinge, er gründete um ca. 600 v. Chr. auch diesen Kult) oder eine Reise zu den bis zu 3'000 Jahre alten Steinzeichnungen in Gobustan sind nur einige von unzähligen Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen.
(siehe Abbildung) und dem Schirwan-Schah-Palast, Gespräche mit geduldigen Teppichhändlern, das Ausprobieren von diversen Speisen, Besuche in Feuertempeln, wo früher die Feueranbeter des Zoroastrismus lebten (der gute alte Zarathustra sprach also nicht nur verschiedene Dinge, er gründete um ca. 600 v. Chr. auch diesen Kult) oder eine Reise zu den bis zu 3'000 Jahre alten Steinzeichnungen in Gobustan sind nur einige von unzähligen Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen.
Vom Winde verweht
Eine von verschiedenen Theorien, woher der Name Baku stammt, lautet, dass der persische Begriff "bad kube", was als "Stadt der Winde" übersetzt werden kann, Namensgeber war.
Bis vor wenigen Tagen habe ich im meist windstillen Baku an dieser Theorie sehr stark gezweifelt, bis dann plötzlich sehr starke Winde aufkamen. Winde, die als eine angsteinflössende Mischung aus Herbst- und Sandstürmen beschrieben werden können. Diese Winde wehten so heftig, dass sie auf der Autobahn einen (wenn auch sehr kunstvoll und entsprechend hoch) mit Heuballen beladenen Lastwagenzug umgeworfen haben.
Ein Tag später herrschte aber bereits wieder schönstes Herbstwetter bei fast 30 Grad Celsius und nichts erinnert an die wahre Herkunft des Namens Baku.
“Do you speak english?” – “Yes, of course…”
Und was sag ich zu den Aseris? Nun es ist sehr einfach: Die Leute sind so freundlich und hilfsbereit, es ist schon fast unheimlich. Sogar die Polizisten sind in der Regel sehr freundlich, auch wenn sie natürlich meistens ihre durch Pflichtgefühl getarnte Neugier voll ausleben und immer wieder Gepäck und Pass kontrollieren. Doch meistens enden solche Kontakte mit einem freundlichen Händedruck. "Trinkgeld" musste ich nie bezahlen.
Auf der Strasse oder im Restaurant erregte ich als Tourist trotz des sehr kosmopolitischen Flairs von Baku immer wieder die Aufmerksamkeit der Leute. Es wird neugierig gefragt - und das zum Glück nicht allzu selten in Englisch - so dass mein Sprach-Manko nicht extrem negativ ins Gewicht fällt.
Den meisten Aseris, vor allem hier in der Hauptstadt, geht es gut. Es geht ihnen so gut, dass sie gut überleben und sich vielleicht sogar den einen oder anderen bescheidenen Luxus leisten können. Es geht ihnen aber nicht so gut, dass sie gross sparen könnten, ganz zu schweigen davon, dass sie irgendwann einmal eine grosse Reise unternehmen könnten.
Und so kommt bei den meisten Gesprächen früher oder später das Thema Geld auf den Tisch. Wieso es möglich sei, dass ich eine solche Reise machen kann. Was ich arbeite und wie viel ich verdiene. Und auch immer wieder die Frage, ob ich wüsste, ob sie in der Schweiz arbeiten könnten.
An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass ich sofort merke, was für ein aussergewöhnliches Subjekt ich bin, wenn ich die von den Kaukasen generell häufig gestellte Alters- und Verheiratet-oder-nicht-Frage ehrlich beantworte: Dem mitleidigen Lächeln folgen sofort die ersten Versuche, mich mit der Tochter des Kollegen oder der Schwester des Onkels zu verheiraten. Denn spätestens mit 26 sind hier alle Männer verheiratet und Väter, die Frauen sollten den Zivilstandswechsel noch einige Jahre früher vornehmen, um nicht unangenehm aufzufallen.
Öl und Demokratie?
Das Öl hat Baku viele tolle Gebäude und eine spannende Vergangenheit gebracht. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts lieferte Baku mehr als die Hälfte des weltweit geförderten Erdöls! Nach einem grossen zwischenzeitlichen Einbruch dieses lukrativen Wirtschaftszweiges keimt nun neue Hoffnung auf. Vor knapp zehn Jahren unterzeichnete der mittlerweile über 80 Jahre alte Präsident von Aserbaidschan, Heydar Aliev, den von ihm sogenannten "Jahrhundertvertrag", der mit 7.4 Mrd. Dollar dotiert ist und die Ausbeutung der vor Baku neu entdeckten Ölfelder bis ins Jahr 2024 regelt.
Das Öl vor Baku hat in der Vergangenheit einige wenige Personen und Organisationen reich gemacht. Und kaum jemand aus der "normalen" Bevölkerung, der bis jetzt noch nicht vom Ölgeschäft profitiert hat, hat ernsthafte Hoffnungen, dass er in irgendeiner Weise von diesem neuen Vertrag profitieren wird.
Das hindert den schwer kranken Aliev aber nicht daran, das gemeine Stimmvolk für den im Oktober anstehenden Wahlkampf nicht zuletzt mit seinen erfolgreichen Vertragsverhandlungen für seine Wiederwahl zu ködern.
Im Oktober sind demokratische Wahlen um das Präsidentenamt angesetzt. Um zu merken, dass bei diesen Wahlen ganz eigene Gesetze herrschen, nämlich die Gesetze des amtierenden Präsidenten, muss man nur durchs Land fahren. Überall hängen die Aliev-Wahl-Plakate, auch im hintersten und letzten noch so verlassenem Dorf, an den möglichsten und unmöglichsten Orten. Es sind Plakate mit dem händeschüttelnden, ernst und wichtig dreinblickenden, militärische Posen einnehmenden, staatsmännisch lächelnden, väterlich beschützenden, erfolgreich verhandelnden Präsidenten.
Die Plakate hängen in Schaufenstern, in Schulen und an Kirchenfenstern, an Bussen und Kiosken und dürfen nur gegen Bezahlung einer hohen Busse entfernt werden. Dass sie aufgehängt werden, darüber wird kaum diskutiert, denn nur die wenigsten haben den Mut, sich dagegen zu wehren. Zudem verfügt die Opposition nicht über genügend (Geld-)Mittel, um dem Aliev-Clan gefährlich zu werden. Dies nicht zuletzt deswegen, weil die aggressive Herrschaft des Greises alle Opposition mit den verschiedensten Mitteln erfolgreich bereits im Keim erstickt.
Doch trotzdem geht es den meisten Aseris finanziell besser  als den Georgiern; der Lebensstandard ist höher, die Leute sind verwöhnter und haben andere "Sorgen" als ihre westlichen Nachbarn (siehe Bild: Vergnügungspark in Baku). Überhaupt kann ich die in den Reiseführern dokumentierte Meinung teilen, dass Baku, obwohl geographisch die östlichste Stadt des Kaukasus, bei weitem die "westlichste" Stadt ist.
als den Georgiern; der Lebensstandard ist höher, die Leute sind verwöhnter und haben andere "Sorgen" als ihre westlichen Nachbarn (siehe Bild: Vergnügungspark in Baku). Überhaupt kann ich die in den Reiseführern dokumentierte Meinung teilen, dass Baku, obwohl geographisch die östlichste Stadt des Kaukasus, bei weitem die "westlichste" Stadt ist.
So ist zum Beispiel der Tanga-Faktor hoch in Baku. Werbungen für Schönheitsoperationen, Kleinkredite und Autos deutscher Bauart sind allgegenwärtig. Es gibt zwar auch Marschrutkas, doch diese werden mit offiziellen Haltestellen gebändigt und es kann sogar vorkommen, dass sich potenzielle Fahrgäste wegen Platzmangel weigern in ein Fahrzeug zu steigen, in welches in Georgien eine sechsköpfige Familie samt Gepäck ohne mit der Wimper zu zucken eingestiegen wäre.
Diesen höheren Lebensstandard haben die Aseris wie schon erwähnt in erster Linie den reichen Bodenschätzen zu verdanken. Dass die Förderung von Erdgas und Erdöl nicht spurlos an der Natur vorbeigeht, kann man eindrücklich an der Landschaft um Baku erkennen. Surrealistisch anmutende, durch ihre Unwirklichkeit eine gewisse Ästhetik gewinnende Kunstlandschaften aus schwarzen Seen, kaputten Röhren und hunderten von ausser Betrieb gesetzten Bohrtürmen bestimmen die Landschaft.
Doch natürlich ist es ein Einfaches, mit dem Finger auf diejenigen zu zeigen, die die Drecksarbeit leisten und entsprechend auch den Schmutz haben. Sitzen wir nicht alle im selben Boot? Und mit dieser ach so gescheiten Bemerkung will ich auch gleich noch eine Geschichte einleiten, die ich zwar in Georgien geschrieben habe, doch irgendwie fast noch besser nach Baku passt.
Das Los der Schwere
Beinahe schwerelos hebt er immer wieder vom Boden ab, dreht sich in alle Richtungen, lässt den Wind mit sich spielen. Dann verharrt er minutenlang regungslos, bis er von Neuem erwacht. Er bläht sich auf und fällt wieder in sich zusammen, macht leise raschelnd auf sich aufmerksam, um seinen nächsten, bald bevorstehenden Flug anzukünden.
Dieser nächste Flug, eingeleitet wie die meisten bisherigen durch eine elegante, spiralförmige Aufwärtsbewegung, mag ihn vielleicht weiter fort tragen, weiter weg von den Städten und Siedlungen, weg von seiner Heimat also. Doch meistens kommt er nicht weit: Ein grosser Busch, der gierig seine Finger in die Luft streckt, fängt ihn auf, den Plastiksack. Dort hängt er dann für längere Zeit, zugleich als fröhlicher Farbtupfer in der Landschaft, aber auch als Fahne für das, was wir Fortschritt nennen. Als Mahnmahl für die Zeit, in der wir leben.
Seemannsgarn
Ein weiteres Kapitel aus "Marc, der (verhinderte) Seefahrer" gefällig?
Es hätte ja wirklich eine Geschichte mit Happy End werden können. Und das ganz speziell hier in Baku. Baku hat nämlich einen Hafen. Und es gibt Schiffe, die auch Personen transportieren. Und es gibt auch so etwas wie einen Fahrplan.
Ok, die Fahrpläne stehen nirgends geschrieben und die Schiffe sehen eher wie bewegliche Altmetallsammelstellen aus. A propos Altmetall: Ich hatte zu erwähnen vergessen, dass in Georgien der Export von Altmetall die wichtigste Devisenquelle ist. So ist es auch kein Wunder, dass ab und zu ein Kanalisationsdeckel auf der Strasse fehlt. In Aserbaidschan ist Erdöl die Einnahmequelle Nummer eins. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Von Baku werden via das Kaspische Meer Häfen in Turkmenistan, Kasachstan und den Iran angefahren. Der Iran liegt nicht auf meiner Reiseroute. Turkmenistan wäre toll, sozusagen mein Wunschtransitland. Der angesteuerte Hafen wäre Turkmenbaschi gewesen. Dieser Ort heisst gleich wie sich der derzeitige Herrscher/Diktator dieses Landes nennen lässt, also Papa aller Turkmenen. Dass dieser Papa einen leichten Hang zum Wahnsinn hat, habe ich selber noch nicht erfahren, doch von verschiedenen Seiten gehört. So oder so bräuchte ich ein Visum, auch wenn ich das Land nur auf dem schnellstmöglichen Landweg durchqueren möchte.
“Chancenlos!”, so die lapidare Antwort eines Mitarbeiters des rennomiertesten Reisebüros von Baku auf meine diesbezügliche Frage.
Einmal leer Schlucken und auf die Zähne beissen, Seefahrer Marc!
Dass es nicht unmöglich ist, ein Visum für Turkmenistan zu erhalten, habe ich wenige Tage später erfahren, als ich den Franzosen Benoit kennen gelernt habe, der, wenn alles geklappt hat, nun in Turkmenistan ist und zwar mit einer aus Baku ausgelaufenen Fähre. Dazu gilt es zu ergänzen, dass Benoit selber im diplomatischen Dienst steht und vor seinem Reiseantritt drei geschlagene Wochen auf das Visum warten musste.
Aber da ist ja noch Kasachstan, Usbekistans nördlicher Nachbar. Alle zwei Tage fahre eine Fähre nach Kazachstan, heisst es von Seiten des Reisebüros. Als ich dann in der Hafenadministration nachfrage, wird mir erklärt, dass das theoretisch stimme, dass es aber kleine Änderungen gegeben habe und somit heute eine Fähre fahre und dann in zehn Tagen die nächste.
Schnell merke ich, dass in zehn Tagen mein Visum für Aserbaidschan abläuft und zehn weitere Tage in und um Baku wären dann doch zuviel des Guten gewesen.
So habe ich mich trotz dem Landreise-Vorsatz nach einem Flug erkundigen müssen und dieser findet planmässig morgen Abend statt.
Nachdem ich das Flugticket gekauft hatte, stellte sich heraus, dass vielleicht trotzdem schon früher eine Fähre fahren würde. Doch noch immer konnte mir niemand mit Sicherheit sagen, ob ich nun ein Visum brauche, um Kasachstan zu durchqueren oder nicht. Zudem hat mir Benoit auch noch erklärt, dass es schwierig werden könnte, von Kasachstan nach Usbekistan zu gelangen, da es für Touristen verbotene Zonen gibt. Zum Beispiel weil dort Atomtests stattgefunden haben. Deshalb bin ich auf einmal nicht mehr so traurig, dass ich das mir selber auferlegte Landreise-Dogma bald durchbrechen werde.
19. September 2003
Taschkent (Usbekistan)
Über den Wolken gibt's Kaviar
Was ich im letzten Blog verschwieg, gestehe ich nun reumütig ein: Ich bin nicht nur geflogen, sondern ich habe Mutter Erde auch noch in einem Business Class-Sitz verlassen! Meine Entschuldigung für dieses gar nicht rucksacktouristenmässige Verhalten ist die folgende: Ich hatte schon seit längerer Zeit das grosse Bedürfnis, so schnell wie möglich Kirgistan zu erreichen... Die aufmerksame Leserin legt die Stirn in Falten und denkt, dass das jetzt aber gar weit vorgegriffen sei. Richtig, Usbekistan soll natürlich vorher auch noch gewürdigt werden. Und in der ursprünglichen Reiseplanung (falls es so etwas überhaupt gegeben hat...), hatte Usbekistan einen grösseren Stellenwert als Kirgistan eingenommen. Doch genau solche Entscheidungen treffen zu können ist der ganz grosse Luxus auf einer derartigen Reise - und ich schätze das sehr.
Nun, die Sache mit Kirgistan ist die folgende: Das Land besteht fast vollständig aus Bergen und hat eine durchschnittliche Meereshöhe von 2750m. Und gemäss diversen Berichten wird es in Kirgistan ab September aus nachvollziehbaren Gründen (Umweltingenieurinnen und Umweltingenieure mögen sich vielleicht an den trockenadiabatischen Temperaturgradienten erinnern) empfindlich kalt. Und da ich in und um Baku fast alles, was ich zu sehen gehofft hatte, gesehen hatte, wollte ich nicht darauf warten, bis in ein paar Tagen ein weiterer Flieger mit freien Economy-Plätzen nach Taschkent abheben wird. Denn jeder Tag Verspätung lässt das Quecksilber in Kirgistan weiter sinken. Darum also diese "geschäftliche" Entscheidung, daher der dargereichte Kaviar.
Leicht vorstellbar, dass ich ein mulmiges Gefühl hatte, die Marschrutka mit der Aufschrift "Aeroport" zu besteigen. Diese ist aber natürlich nur in die Nähe des Flughafens gefahren, so dass ich trotzdem ein weiteres Mal in den Genuss kam, mit dem Taxifahrer einen einem Touristen angemessenen Fahrpreis auszuhandeln.
Dann die mühsamen Flughafen- und Check-In Formalitäten, bevor wenig später das Kaspische Meer unter mir vorbeigezogen wird. Wie ein Wink des Überland-Reisegottes ist es mir vorgekommen, als ich bemerkte, dass ich das erste Mal durch eigenes Verschulden (oder war es ein derart geschickter Diebstahl?) im Flughafen von Baku etwas verloren hatte. Zwar nichts Unverzichtbares wie den Reisepass oder die Kreditkarte - doch immerhin eine Plastiktasche mit den Reiseführern und einem Sprachbuch. Das mit dem Reiseführer hat mich schon ein bisschen beschäftigt, doch schon bald konnte ich Kopien eines identischen Exemplars machen und heute bin ich sogar wieder stolzer Besitzer eines eigenen Reiseführers, der mir eine Usbekistan-Reisende kurz vor Ihrer Heimreise überlassen hatte. Immer wieder nervt mich jedoch der Verlust meines Sprachführers, der mir relativ einfach erlaubt hätte, mehr als nur "Hallo", "Auf Wiedersehen" und die Zahlen von eins bis zehn in der jeweils aktuellen Sprache zu lernen.
Doch dass ich russisch oder usbekisch spreche, scheint gar nicht immer nötig zu sein, da ich immer wieder von Studentinnen und Studenten in bestem Englisch angesprochen wurde, welche ganz offensichtlich eine grosse Freude daran haben, das im Hörsaal gelernte quasi "im Alltag" anwenden zu können.
Eine Busfahrt, länger als ein Leben
Die durch Schubkraft und kluge Aerodynamik beschleunigte Ostreise wurde schon bald wieder verlangsamt. Das Flugzeug hatte mich nämlich so weit in den Osten getragen, dass ich als nächstes richtig heftig in westliche Richtung korrigieren musste.
Nachdem ich in Taschkent problemlos und innerhalb 30 Minuten mein Kirgistan-Visum erhalten hatte, machte ich mich auf zur Fahrt nach Khiva, standesgemäss im Bus. Khiva ist neben Bukhara und Samarkand die drittwichtigste Destination für Touristen in Usbekistan und liegt rund 1'100km südwestlich von Taschkent nahe an der turkmenischen Grenze.
Die Busfahrt verlief abwechslungsreich und wurde durch mindestens zwanzig Polizei-, Grenz-, Pass-, Zoll- oder sonstige Kontrollen weiter aufgelockert.
Da ich vermutete, dass die Busreise eine Weile dauern würde, habe ich mich zu Beginn der Reise vor allem im Gang des Busses stehend aufgehalten. Nach einigen Sitztauschmanövern meiner Sitznachbarn musste ich dann auf einmal feststellen, dass ich keinen Sitzplatz mehr hatte. Auf geheimnisvolle Weise ist er verschwunden und natürlich ist ein solcher Zauber nicht wieder rückgängig zu machen. Nun gut, die freundliche Buscrew hatte mich als einzigen "Fremden" sowieso schon lange adoptiert, so dass ich ohne Probleme etwa ein halbes Füdli auf die für die Chauffeure improvisierte Liegebank setzen konnte.
Als Entschädigung für den verlorenen Sitzplatz hat mich die vierköpfige Buscrew (zwei Fahrer, ein Billettkontrolleur und ein Mechaniker) zudem beim Restaurantzwischenhalt eingeladen, mit ihnen zu schlemmen.
Was ich mir schon immer gedacht, aber noch nie zu fragen gewagt hatte, bewahrheitete sich an diesem Abend: Als Dankeschön, eine ganze Busladung voller müder aber auch hungriger und durstiger Menschen vor einem Restaurant abgeladen zu haben, können die Mitglieder der Buscrew nach Herzenslust bestellen und essen was sie mögen, ohne dafür später eine Rechnung bezahlen zu müssen.
Und wie dann geschlemmt wird: Auf den usbekisch-orientalischen Ess-Liegen spielen sich Szenen ab, die man bestens aus den Asterix & Obelix-Bänden kennt. Wobei, und das muss ich der Crew zugute halten, Alkohol wurde nicht angerührt. Dafür war es an mir, die bestellte Flasche Vodka aus dem Restaurant zu schmuggeln, für spätere Gelegenheiten, wie mir versichert wurde...).
Einige Polizeikontrollen, Pinkel- und Motorreparaturpausen später, also nach total 21 Stunden, kann es dann nicht mehr weit sein: Ich merke es den fröhlichen Gesichtern der Buscrew an. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung, sie singen und pfeifen, sichtlich froh, diese Reise wieder einmal ohne grössere Pannen überstanden zu haben.
Achtung ein Reisecar, die Touristen kommen!
Über Khiva, Bukhara und Samarkand mag ich nicht allzu viel schreiben, da schon genug  darüber gesagt und geschrieben worden ist. Ohne Zweifel sind es Städte und Monumente von historischer Bedeutung, doch die museumartige Herrichtung und die allgegenwärtigen Souvenirverkaufsstände (im Bild die sehr sympathische - die Ausnahme bestätigt die Regel - Souvenirverkäuferin Roxana) lassen nicht wirklich ein Gefühl von historischer Ehrfurcht aufkommen. Und auch die im Vergleich zu den lokalen Lebenshaltungskosten exorbitanten Eintrittspreise zu den Sehenswürdigkeiten sind abschreckend.
darüber gesagt und geschrieben worden ist. Ohne Zweifel sind es Städte und Monumente von historischer Bedeutung, doch die museumartige Herrichtung und die allgegenwärtigen Souvenirverkaufsstände (im Bild die sehr sympathische - die Ausnahme bestätigt die Regel - Souvenirverkäuferin Roxana) lassen nicht wirklich ein Gefühl von historischer Ehrfurcht aufkommen. Und auch die im Vergleich zu den lokalen Lebenshaltungskosten exorbitanten Eintrittspreise zu den Sehenswürdigkeiten sind abschreckend.
Spannend scheint mir vor allem die Vorstellung, wie es für die Mitglieder einer Karawane gewesen sein muss, die noch keine grössere Stadt gesehen haben und dann nach wochenlangen Ritten durch karge Wüstenlandschaften in Samarkand (im Bild Detail aus Samarkand) angekommen sind. Ungläubig wischen sie sich den Staub aus den Augen und stehen, sitzen oder knien vor diesen beeindruckenden, mächtigen und farbenprächtigen Bauwerken. Türkis leuchten die Kuppeln der Minarette und Moscheen in der Wüstensonne, blenden die vor allem an Grau- und Brauntöne gewohnten Augen.
angekommen sind. Ungläubig wischen sie sich den Staub aus den Augen und stehen, sitzen oder knien vor diesen beeindruckenden, mächtigen und farbenprächtigen Bauwerken. Türkis leuchten die Kuppeln der Minarette und Moscheen in der Wüstensonne, blenden die vor allem an Grau- und Brauntöne gewohnten Augen.
Mister, mister, pen, yes...?!"
Polo National und sein Gassenhauer "Kiosk" ist mir ab und zu in den Sinn gekommen, als ich durch die historischen und klinisch sauber aufgeräumten Gassen von Khiva oder zwischen den Monumenten von Bukhara und Samarkand umhergelaufen bin.
Es mag ja eine gute Idee sein, wenn Touristen vor Reisen in Entwicklungsländern der Rat gegeben wird, genügend Kugelschreiber oder Bonbons mit in den Rucksack zu packen. Doch meiner Meinung nach macht das vor allem dort Sinn, wo ein wirklicher Bedarf an zum Beispiel Kugelschreibern besteht.
Richtig, grundsätzlich kann man nie genug Kugelschreiber haben, denn wie schnell sind sie verloren, verlegt oder vergessen...
Doch die Kinder in diesen von den Touristen heimgesuchten Ortschaften scheinen sich einen Sport daraus gemacht zu haben, jede Person um einen Kugelschreiber anzubetteln, obwohl sie höchstwahrscheinlich schon Dutzende zu Hause herumliegen haben.
Da war doch einmal ein See
Mit einem leicht schlechten Gewissen machte ich mich auf nach Muynak, das vor einigen Jahrzehnten die grösste usbekische Stadt am Aralsee war. Dutzende Fischerboote verliessen täglich den Hafen von Muynak, um später mit grossem Ertrag zurückkehrten. Heute ist von der  grossen Vergangenheit nicht mehr viel zu spüren und auch der Aralsee, dessen Ufer nun rund 140km von Muynak entfernt sind, scheint nicht mehr viel mehr als ein Gerücht.
grossen Vergangenheit nicht mehr viel zu spüren und auch der Aralsee, dessen Ufer nun rund 140km von Muynak entfernt sind, scheint nicht mehr viel mehr als ein Gerücht.
Rostige Fischkutter liegen auf dem Trockenen, das einstige Ufer das ehemals zweitgrössten Sees der Erde fällt nun rund fünfzehn Meter tief in eine Steppenlandschaft ab. Angesichts dieses Bildes fällt es mir schwer, das Geräusch von ans Ufer klatschenden Wellen vorzustellen (siehe Bild der Ziegen vor einem Schffswrack).
Das schlechte Gewissen kam daher, dass ich schon viel über die "Umweltkatastrophe am Aralsee" gelesen hatte und somit bei einem Besuch dieses Gebietes zurecht Katastrophentourist oder Gaffer genannt werden kann. Denn neben den verheerenden Auswirkungen auf die Wirtschaft der vom Fischfang abhängigen Städte am Aralsee leidet auch die Gesundheit der Anwohner. Spürbare Auswirkungen sind unter anderem die höheren Durchschnittstemperaturen und die geringeren Niederschläge. Zudem verursacht der giftige Feinstaub, der durch die stärker gewordenen Winde über weite Strecken transportiert wird Lungenkrankheiten, Fehlgeburten und Missbildungen.
Doch ich wurde zum Glück positiv überrascht: Die Stimmung in der noch 2'000 Einwohner zählenden Stadt ist - so gut ich es während meines Kurzbesuchs feststellen konnte - bei weitem nicht so hoffnungslos, ist wie ich befürchtet hatte, beziehungsweise wie es in Reiseführern beschrieben wurde. Spielende und lachende Schulkinder auf den Strassen, geschäftige Personen hier und da; das Leben nimmt auch hier seinen Lauf und die Bewohner - falls sie sich selbst überhaupt noch an den Aralsee erinnern können - scheinen sich an Touristen, die mit Kameras bewaffnet um die rostigen Schiffsskelette spazieren, gewöhnt zu haben.
feststellen konnte - bei weitem nicht so hoffnungslos, ist wie ich befürchtet hatte, beziehungsweise wie es in Reiseführern beschrieben wurde. Spielende und lachende Schulkinder auf den Strassen, geschäftige Personen hier und da; das Leben nimmt auch hier seinen Lauf und die Bewohner - falls sie sich selbst überhaupt noch an den Aralsee erinnern können - scheinen sich an Touristen, die mit Kameras bewaffnet um die rostigen Schiffsskelette spazieren, gewöhnt zu haben.
An der Strasse von und nach Muynak konnte ich Arbeiterinnen und Arbeiter bei der Baumwoll-Ernte beobachten. Die Bewässerung eben dieser Baumwollfelder ist einer der Hauptgründe, wieso die Zuflüsse in den Aralsee um- und abgeleitet werden und ihn somit langsam zum verschwinden bringen. Und was macht man schon wieder aus Baumwolle? Und wie war das schon wieder mit den Ölfeldern in Baku? Hmm...es ist immer noch das selbe Boot, scheint mir.
Gesucht: Das letzte Abenteuer
Was ich zu guter Letzt nicht zu bemerken vergessen will, ist, dass all die Befürchtungen vor übergenauen und mühsamen Polizeikontrollen auf den Strassen oder in der Metro absolut unbegründet waren. Die Polizisten haben sich, falls sie mich nicht komplett in Ruhe gelassen haben, als äusserst korrekt, freundlich und hilfsbereit erwiesen. Gleiches kann man auch von den Bewohnern dieses Landes sagen: Durchwegs hilfsbereit, freundlich, zuvorkommend. Oder um es anders auszudrücken: Wer wirklich eines der letzten Abenteuer dieser Erde sucht, ich glaube, er oder sie wird es nicht in Usbekistan finden. Zu organisiert und geregelt ist schon ein Grossteil dieses Landes, in dem sich einst magische Seidenstrassengeschichten abgespielt haben mögen.
13. Oktober 2003
Osh (Kirgistan)
Kirgistan im September und Oktober - Wo ist der Schnee, wo bleibt die Kälte?
Kirgistan hat sich als die erhoffte und erwartete Rückkehr zum Einfachen  herausgestellt. Keine pompösen Monumente, keine aufdringlichen Souvenirverkäufer. Das einzige Schauspiel ist die Natur und die verlangt in der Regel keinen Eintritt, ausser sie hat sich dummerweise gerade auf eine Grenze gesetzt, zum Beispiel auf diejenige zu China.
herausgestellt. Keine pompösen Monumente, keine aufdringlichen Souvenirverkäufer. Das einzige Schauspiel ist die Natur und die verlangt in der Regel keinen Eintritt, ausser sie hat sich dummerweise gerade auf eine Grenze gesetzt, zum Beispiel auf diejenige zu China.
Und trotzdem, nicht alles was gratis ist, ist nichts wert: Die Natur verwandelt sich von Stunde zu Stunde neu und verzaubert den Betrachter ohne Vorspiegelung falscher Tatsachen. Oder kennt jemand einen Berg, der sagt "Bin im Fall ein echter Granit!", obwohl alle Füchse und Perlhühner im Umkreis von 50km genau wissen, dass er nur ein einfacher Sandstein ist?
Kirgistan ist fünf Mal so gross wie die Schweiz und besteht praktisch nur aus Bergen, 40% davon strecken sich mindestens 3'000 Meter über das Meeresniveau 'gen Himmel. Und in der Höh', da ist es kalt und dies zunehmendermassen im Herbst und Winter. Und deshalb habe ich mich ja seit Baku auch so beeilt, um nach Kirgistan zu kommen. Denn ich wollte nicht zu spät ankommen und vom Land nur noch - wie nach einer Schneeflut - die höchsten Berggipfel sehen.
Doch alle derartigen Befürchtungen haben sich als unbegründet herausgestellt. Klar, für die schwierigen Hochtouren war es viel zu spät. Aber das Bezwingen des einen oder anderen 7'000ers stand auch gar nie auf meiner Wunschliste.
Ich wäre gerne in die Nähe eines der Bergriesen gegangen, doch dagegen haben neben der aufwändigen Anreise auch die lächerlich teuren militärischen Bewilligungen gesprochen, die für den Zutritt zu den sich meist direkt auf der Landesgrenze befindenden Berge verlangt werden. Anstelle der befürchteten Schneestürme präsentierte sich Kirgistan von seiner besten Seite: Mildes, sonniges Herbstwetter, welches das vom langen Sommer ausgetrocknete Land in atemberaubenden Gelb-, Orange- und Goldtönen erleuchten liess.
Und wenn es dann mal so richtig kalt wurde in der Höhe, dann war die nächste heisse Quelle sicher nicht weit und beim Eintauchen in dieselbe wurde das frostige Frösteln bald in ein wohliges Wohlgefühl verwandelt.
"Taschkent – Osh einfach" - oder doch kompliziert?
Bevor ich in Kirgistan innerhalb von fast vier Wochen einige Dinge erleben konnte, die ich für so bemerkenswert halte, dass ich sie hier in diesem Blog notiere, musste ich erst einmal aus Usbekistan in die russische Alpenrepublik einreisen.
Um auf dem Landweg und ohne ein Nachbarland zu durchqueren nach Kirgistan zu gelangen, bot sich einzig die Route Taschkent - Osh durch das Fergana-Tal an. Nachdem ich erfragt hatte, welches der richtige Busbahnhof für die Fahrt nach Kirgistan ist, bin ich rucksackbeladen und auch sonst deutlich als Tourist erkennbar dorthin gefahren.
Das "Abenteuer Grenzübertritt" beginnt spätestens auf den Busbahnhöfen, denn meine Touristen-Kluft scheint auf die anwesenden Taxifahrer eine unwiderstehliche Anziehungskraft auszuwirken, so dass ich mich bei solchen Gelegenheiten eher wie ein verwesendes Stück Fleisch fühle, auf das sich gierig die Geier stürzen, denn wie ein Mensch.
Natürlich habe ich versucht, mich vorgängig über den "richtigen" Preis für diese Strecke zu erkundigen. Doch die Umstände sind halt nicht immer die gleichen - und vor allem der Benzinpreis! - ja, der Benzinpreis ist es, was den Taxifahrern immer wieder wie auf Kommando die Tränen in die Augen treibt, wenn der unwissende Tourist einen viel zu tiefen Preis vorschlägt.
Ein Königreich für ein Taxometer, ein Stossgebet für die Einführung von einheitlichen Tarifzonen!
Doch nix da, es muss tapfer verhandelt werden. Und einer bleibt bei derartigen Verhandlungen meist der Sieger. Wer es war, merke ich spätestens dann, wenn mich mein Taxifahrer auf der Fahrt grosszügig zum Mittagessen einlädt (Kosten: ca. 70 Rp.) und mich unterwegs immer wieder freundlich mit den süssesten Melonen oder mit für meine Geschmacksnerven ekligen Käsebällchen versorgt. Dass seine Freundlichkeit noch einen anderen Grund hat, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, denn ich fühlte mich in Sicherheit, hatte ich mir doch in Taschkent für 20 US$ die etwa 400km lange Fahrt von der usbekischen Hauptstadt nach Osh erstanden.
Das meinte ich jedenfalls. Doch als in Kolkand, nach nicht einmal der Hälfte der Strecke, die anderen Mitreisenden - die dem Fahrer selbstredend nur einen Bruchteil meines Betrages entrichtet haben - am Ziel ihrer Fahrt waren, wurde ich freundlich an ein anderes Taxi weitergereicht, welches mich bis Andijan, der letzten grösseren Stadt vor der Grenze bringen sollte und dies auch tat.
Mein ursprünglicher Fahrer und erster Vertragspartner hat der Taxifahrerin (ein seltenes Exemplar, denn ich habe generell kaum Frauen am Steuer gesehen, was ich auf die Auslegung des Korans zurückführe) sowohl den Obolus für diese Fahrt als auch für den Minibus, der mich später von Andijan an die Grenze bringen sollte, ausgehändigt.
Nun, was soll ich sagen? Ich bin angekommen und zwar zum vereinbarten Fahrpreis, habe zudem statt einer Taxifahrt drei erlebt, dabei zwei Taxifahrer und eine Taxifahrerin und deren Passagiere kennen gelernt. Und dass es aus visatechnischen Gründen gar nie möglich war, mich direkt bis nach Osh zu bringen, habe ich dann auch noch gemerkt. Aber zum Glück befindet sich Osh sehr nah an der Grenze zu Usbekistan, so dass dieser Mehrpreis zum ursprünglich ausgehandelten Fahrpreis zu verkraften war.
Ein warmer See auf 1600 Meter über Meer
Bei einer Reise in Kirgistan werden die meisten Besucher zumindest in die Nähe des Issyk-Köl, des "warmen Sees" kommen, wenn sie den Seeriesen (Ost-West-Ausdehnung ca. 170km, Nord-Süd-Ausdehnung max. 70km) nicht sogar ganz umrunden.
"Warmer See" ist ein treffender Name, denn der zweitgrösste Bergsee der Welt friert nie zu und lädt noch im Oktober mit angenehmen 18 Grad Celsius zum Bade ein.
Erstaunt stellte ich zudem fest, dass sich der See eher wie ein Meer verhält: Der leicht salzige Geschmack auf den Lippen, die ansehnlich hohen Wellen und die deutliche erkennbare Verschiebung der Uferlinie lassen ein Meer im Seepelz vermuten. Der hohe Salzgehalt wird von den Experten dadurch erklärt, dass der Seespiegel nicht durch Abflüsse sondern rein durch Verdunstung reguliert wird. Der See ist stellenweise fast 700m tief. Diese grosse Tiefe sowie unterirdische thermische Aktivitäten sind Erklärungen dafür, dass der See auch im härtesten Bergwinter nicht zufriert. Dass der Issyk-Köl Ebbe und Flut zeigt, haben wir in angeregten Diskussionen unter Reisenden der Grösse des Sees, dem Mond und Newton zugeschrieben.
CBT - die wahre Bedeutung
CBT, also "Community Based Travel" - neben "Shepards Life" die zweite von der Helvetas unterstützte Organisation zur nachhaltigen Förderung des Tourismus unter Einbezug der lokalen Bevölkerung - bietet wertvolle Dienste an, wenn es darum geht, Übernachtungsmöglichkeiten, Ausritte zu Pferd oder den Kauf einer Yurte zu organisieren. Wirklich nah an der Bevölkerung und Wohltäter für eine weitaus grössere Anzahl von Personen ist man aber immer dann, wenn man ein Transportmittel benötigt, aber keine öffentlichen Busse oder Minibusse verkehren.
Auf meiner Fahrt von Kochkor nach Osh habe ich in Chaek übernachtet und mich dort erkundigt, wie ich am einfachsten ins 40km entfernte Kyzyl-Oy kommen könnte.
Hui, das wird schwierig, denn die beiden Dörfer sind nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden. "Ja, aber es kann doch sein, dass jemand im anderen Dorf einen Kollegen besucht oder etwas vorbeibringt", habe ich auf hand-und-fussisch zu erklären versucht. "Nein, nein!" kommt prompt die Antwort, "die Einwohner der beiden Dörfer haben keine Freunde untereinander, da sie zu verschiedenen Provinzen gehören. Chaek gehört zur Naryn-Provinz, Kyzyl-Oy dagegen zur Bishkek-Provinz. Die einzige Möglichkeit, nach Kyzyl-Oy zu gelangen, ist ein Taxi zu nehmen."
Das wäre ja gelacht, habe ich mir gedacht, wenn es nicht einige Leute gibt, die in die von mir angestrebte Richtung fahren würden. Und so bin ich also mit Sack und Pack an die Strasse gestanden.
Schafherden sind an mir vorbeigezogen, Hühner und Enten haben die Strasse überquert, Schulkinder - meist in Uniformen - sind an mir vorbeispaziert; ich habe das halbe Dorf kennen gelernt, nur kein Fahrzeug gesehen, das mich mitgenommen hätte, abgesehen von ein paar Pferde- und Eselwagen.
Doch immerhin bin ich so am Strassenrand wartend - obwohl alle Leute genau wussten, dass es weder öffentlichen noch privaten Verkehr in dieser Richtung gibt - für ein paar Stunden eine willkommene Abwechslung und das Gesprächsthema für ein paar Marktfrauen, ein Rind und ein Dutzend Hühner geworden.
Also dann halt doch ins Stadtzentrum zurück und ein Taxi suchen. Das ist kein Problem, nicht zuletzt deshalb, weil mein erstes Angebot wieder ein bisschen zu hoch war und sofort angenommen wird. Vergebliches Warten macht demütig. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema dieses Abschnittes, dem "Community Based Travel", das ich bei dieser Taxifahrt erneut in Reinkultur erleben durfte.
Mit der ersten Anzahlung meines Fahrgeldes geht der Taxifahrer erstmal beim  Nachbarn Benzin einkaufen. Die "Tankstelle" befindet sich meist im Hinterhof neben der Scheune und dem Misthaufen, die benötigten Utensilien sind ein Eimer voller Benzin und ein Trichter. Als nächstes erhält der Kollege, der sich im Taxi befunden hat, eine gratis Mitfahrt in den nächsten Weiler, wo der Fahrer auch gleich einen Cousin trifft, der sich eine Zigarette schnorrt. Auf der Weiterfahrt kommen wir am Haus des Fahrers vorbei, wo ein Sack Kartoffeln eingeladen wird, welcher nun endlich seinem Bestimmungsort näher kommt. Auch der Bruder, der uns stolz vor seiner Schafherde entgegen reitet, erfährt von der Neuigkeit, dass sich ein Tourist herumchauffieren lässt und erhält dafür eine Zigarette.
Nachbarn Benzin einkaufen. Die "Tankstelle" befindet sich meist im Hinterhof neben der Scheune und dem Misthaufen, die benötigten Utensilien sind ein Eimer voller Benzin und ein Trichter. Als nächstes erhält der Kollege, der sich im Taxi befunden hat, eine gratis Mitfahrt in den nächsten Weiler, wo der Fahrer auch gleich einen Cousin trifft, der sich eine Zigarette schnorrt. Auf der Weiterfahrt kommen wir am Haus des Fahrers vorbei, wo ein Sack Kartoffeln eingeladen wird, welcher nun endlich seinem Bestimmungsort näher kommt. Auch der Bruder, der uns stolz vor seiner Schafherde entgegen reitet, erfährt von der Neuigkeit, dass sich ein Tourist herumchauffieren lässt und erhält dafür eine Zigarette.
Und zu guter Letzt wurde auch noch die Strecke zwischen den zwei Dörfern zurückgelegt. Diese einstündige Fahrt - auf der uns nicht mehr als drei Fahrzeuge entgegenkamen - führte uns entlang einer beeindruckenden Schlucht und ich konnte die Reise beliebig oft unterbrechen um Fotos zu machen, was somit auch mich als einen der Stakeholder des Unternehmens "Taxifahrt" vollständig zufrieden gestellt hatte.
Ich bin auch ein Güterwagen
Ich will es nicht verschweigen, einige Male ist mir das Reisen in den übervollen Bussen in Kirgistan zu viel geworden und ich hatte kurzzeitig und sprichwörtlich die Nase voll von derartigen Transportmitteln.
Meist wird mit grosser Verspätung abgefahren und spätestens nach dem dritten Stopp ist sich niemand mehr seines Stehplatzes sicher. Und natürlich werden nicht nur Personen transportiert, nein ganze Wintervorräte werden nach Hause oder auf den Markt gefahren. Kartoffel-, Mehl-, Zwiebel- und sonstige Säcke füllen den Fahrgastraum, Schachteln voller Eier, riesige Taschen voller Was-Weiss-Ich-Was und natürlich mein Rucksack versperren den Weg. Man kommt sich nah, meist so nahe, dass sofort ruchbar wird, weshalb kaum ein Kirgise ein Gebiss ohne Goldzähne hat...
Doch meist überwiegen die positiven Erlebnisse in solchen fahrenden Universen. Viele Geschichten können von den Gesichtern gelesen werden, es wird geschwatzt oder geschlafen, getrunken oder gegessen. Und auch die Solidarität den Alten und Schwachen gegenüber ist gross: Die raren Sitzplätze werden sofort und ohne Zögern freigegeben. Immer ist eine helfende Hand da, wenn es darum geht, die teilweise unglaublich schweren Taschen oder Säcke in den oder aus dem Bus zu hieven. Nie wird gemault oder gemeckert, wenn sich eine weitere vielköpfige Familie, zusammengesetzt aus mindestens drei Generationen, daranmacht, in den eigentlich schon übervollen Bus zuzusteigen.
Adieu Torugart-Tortur - Hallo Irkestan
Eigentlich wollte ich die Herausforderung annehmen und Kashgar, also China, via den berühmt-berüchtigten Torugart-Pass erreichen. Der allgegenwärtige, doch leider über weite Teile veraltete Lonely Planet-Reiseführer (eine neue Auflage soll sich im Druck befinden) widmet dieser Passüberquerung ganze drei Seiten und zeichnet farbige Bilder des administrativen, logistischen und finanziellen Schreckens eines derartigen Vorhabens.
Die unangemessen hohen Kosten, die Unsicherheit über das Verhalten der chinesischen Grenzpolizisten sowie Berichte von japanischen Touristen, dass kürzlich ein Reisebus in einen Hinterhalt geraten und im Schusswechsel alle Passagiere ums Leben gekommen sind, haben das Ihre dazu beigetragen, dass ich mich schliesslich dagegen entschieden habe, das "Abenteuer Torugar zu wagen.
Glücklicherweise gibt es jedoch eine Landwegalternative: Erst seit einigen Jahren ist der Irkestan-Pass, rund 250km süd-östlich von Osh gelegen, offiziell auch für Touristen offen und problemlos zu bewältigen. Die Entscheidung, nicht über den Torugart- sondern über den Irkestan-Pass nach Kashgar zu gelangen, habe ich in Karakol gefällt, rund tausend Kilometer nord-östlich von Osh.
In Kashgar wollte ich meinen ehemaligen Studienkollegen Philip treffen, da er sich nach seinen Arbeiten für seine Doktorarbeit zum Thema Grundwassermanagement noch Zeit reserviert hat, mit mir die nähere Umgebung von Kashgar zu erkunden. Da ich genug Zeit hatte, bis ich Philip in Kashgar treffen wollte, nahm ich mir die viel versprechende und in den Reiseführern nicht beschriebene Route von Karakol nach Kashgar via Kochkor, Chaek, Kyzyl-Oy, Tö-Ashuu und Osh vor.
Und es hat dann tatsächlich auch sechs Tage gedauert, um diese 1'000km zurückzulegen...
"No sleep til Toktogul" oder - Lastwagenfahren in Kirgistan, eine Meditation der Langsamkeit
Nachdem ich mich mit Ach und Krach von Chaek via Kyzyl-Oy nach Tö-Ashuu durchgemogelt hatte, stand ich vor der Bushaltestelle an der Hauptstrasse zwischen Bishkek und Osh und sah mich gerettet, denn diese Route versprach eine viel grössere Anzahl von Fahrzeugen als die eben bewältigte wenig befahrene Bergroute.
Car-Sharing, ein Prinzip, das sich in den sogenannt entwickelten Ländern wie der Schweiz nur mühsam durchsetzt, ist in Kirgistan schon längst etabliert. Kaum ein Auto ist nicht bis aufs Dach bepackt und mit mindestens fünf Passagieren besetzt. Das ist eine tolle Sache, hilft Kosten sparen, ist sowohl ökonomisch als auch ökologisch.
Doch leider kann diese kirgisische Tradition für denjenigen ein Nachteil sein, der noch zusätzlich mitgenommen werden will.
Tja, da stand ich halt wieder, diesmal nur von ein paar Krähen beobachtet, aber ebenso erfolglos wie in den Bergdörfern an den Tagen zuvor.
Schliesslich war ich verzweifelt, ungeduldig - oder glücklich? - genug, dass ich auch bei den vorbeiziehenden Lastwagen (allesamt Kamas, der russische Monopolist unter den LKW-Herstellern) die kirgisische Ruderbewegung vollführte, die anzeigt, dass man auf eine weite Strecke mitgenommen werden will.
Und tatsächlich, einer der ersten Brummis, ein eindrückliches Gefährt mit Anhänger, hielt an und ich kletterte zu dem sehr sympathischen jungen Mann in die Führerkabine.
Natürlich wusste ich, dass Lastwagen langsam unterwegs sind. Aber so langsam? Zu Beginn ist es ja noch ganz lustig, man kann sich bequem kennen lernen, muss nicht so doll auf die Strasse schauen. Aber dann könnte es schon ein bisschen schneller vorwärts gehen. Und erst diese Pässe... Wenige Kilometer (also rund eine Stunde später) nachdem ich zugestiegen bin, beginnt die Strasse sanft anzusteigen. Ein Pass von mehr als 3'000 Meter über Meereshöhe kündigt sich an.
Auf halber Höhe beginnt es zu schneien. Die Ladung - Zementsäcke? - muss abgedeckt werden. Wir stoppen und verrichten die Arbeit gemeinsam. Doch jeder Halt birgt auch die Gefahr, dass der altersschwache Motor nicht mehr anspringt. Was auch prompt passiert.
Nodirbek, so der Name des Chauffeurs, lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen, nestelt an verschiedenen Kabeln herum, drückt eine Pumpe und erreicht in Kürze, dass der Motor wieder anspringt.
Im Lastwagen gibt's im Gegensatz zu radfahrenden Passbezwingern kein Freudengeschrei, wenn die Passhöhe erreicht ist.
Es gilt vielmehr das Motto: Rauf geht's langsam, runter geht's langsamer!
Diese Taktik macht überlebenstechnisch natürlich Sinn, insbesondere wenn man die altersschwachen Bremsen solcher Gefährte bedenkt. Folgedessen waren wir für eine Passstrecke von rund 60km geschlagene viereinhalb (4 1/2!) Stunden unterwegs.
Kleiner Scherz gefällig? Wie bringt man einen Formel-1-Fahrer am schnellsten an den Rand eines Nervenzusammenbruchs? Richtig, man setzt ihn auf den Beifahrersitz eines solchen Lastwagens. Ich bin sicher, diesem Tempo wäre er nicht gewachsen!
Auf der Passabfahrt wurde klar, dass es schon seine guten Gründe hat, wieso wir uns mit Schritttempo vorwärts bewegen. Eine Gerade mit gegen 10% Neigung vor uns, zwanzig Tonnen Ladung hinter uns und eine schneenasse Strasse unter uns sind genug Gründe, die dieses Tempo rechtfertigen. Meine Pläne, erneut den Sonntagsbasar in Osh besuchen zu können, hatte ich schon längst begraben, zu langsam waren wir unterwegs. Doch mir blieb fast keine andere Wahl, als so lange mit Nodirbek mitzufahren, bis wir die nächste grössere Stadt erreichen, um dort auf einen Bus umzusteigen.
Jedes Mal, wenn Nodirbek den Motor abstellt, also zum Beispiel für eine Mittagspause, kann die Wiederaufnahme der Fahrt durch diverse Reparaturarbeiten verzögert werden. Die Führerkabine wird vornübergeklappt, dann wird geschraubt, geklebt, mit Drähten verbunden, mit Tüchern gestopft, Schläuche werden umgeleitet, Kanister dazugehängt. Startversuche, Fehlschläge, erneute Fehlersuche. Und das alles in einer Ruhe, egal ob es schneit, regnet oder ob die Sonne scheint. Kein einziger Fluch, keine böse Bemerkung habe ich von Nodirbek gehört.
"Normalna?!", nicht schlecht, was meinst du, war seine lapidare Bemerkung, als der Motor nach einem längeren Stopp problemlos angesprungen ist.
Doch kurz nach Toktogul, nach einer Mütze voll Schlaf in der Führerkabine, haben sich die Probleme vergrössert. Eine grosse Menge von Kühlwasser bedeckt die Fahrbahn unter dem Kamas. Einige hilflose Versuche, den Motor zu starten bringen nichts. Dem um eine Spur besorgteren Gesicht Nodirbeks ist anzusehen: An eine Weiterfahrt ist in absehbarer Zeit nicht zu denken. Und da somit auch das nächste gemeinsame Ziel, mich für den 07.00-Uhr-Autobus rechtzeitig nach Kara-Köl zu bringen, unerreichbar wird, lässt mich Nodirbek grosszügig ziehen und hilft mir tatkräftig mit, den tatsächlich kurz darauf vorbeifahrenden Autobus abzuwinken.
Eine kurze und bewegende Abschiedsszene und weg bin ich, verschwinde ebenso abrupt aus seinem Leben wie ich darin auftauchen durfte. Natürlich fühlte ich mich ein wenig wie die Ratte, die den sinkenden Kamas verlässt. Aber um Nodirbek brauche ich mir keine Sorgen zu machen, er wird sicher immer einen Weg finden, aus Notlagen herauszukommen. Etwas mehr Sorgen könnten mir die chinesischen Grenzbeamten bereiten, welche mich trotz abgelaufenem Visum in ihre Volksrepublik hereinlassen sollten. Doch das Glück scheint auf meiner Seite zu sein, da ich gerade noch rechtzeitig am Sonntag Nachmittag in Osh eingetroffen bin um herauszufinden, dass am nächsten Morgen früh um 8 Uhr, also in fünf Stunden, ein Minibus in Richtung chinesische Grenze fährt.
China, ich komme! Langsam zwar, aber ziemlich sicher...
15. Oktober 2003
Beijing (China)
Ich bin noch nicht fertig mit Dir...!
Dass ich im aktuellen Blog jeweils eine Rückblende auf den vorangehenden machen muss beziehungsweise machen will, liegt wohl daran, dass ich den jeweiligen Blog noch im eben besuchten Land schreibe, dieses Land aber effektiv noch nicht verlassen habe.
Mir kommt es fast so vor, wie wenn mich das betreffende Land dies auch spüren lassen will. Oder, positiv ausgedrückt, dass mich das Land so lang wie möglich bei sich behalten will...
So passiert auch beim Grenzübertritt zwischen Kirgistan und China. Wie zu Ende des letzten Blogs angetönt, hatte ich am betreffenden Tag um 08.00 Uhr ein Rendez-vous mit einem als Taxi verwendeten Militärjeep. Ich bin dann auch pünktlich am vereinbarten Ort auf ein paar weitere Fahrgäste gestossen, die alle die anstrengende Fahrt zum kirgisisch-chinesischen Grenzort Irkestan anzutreten bereit waren. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich in der Hoffnung, bereits am selben oder spätestens am nächsten Tag chinesischen Boden unter den Füssen zu haben.
Die anfänglich gute Stimmung unter den Wartenden ist zunehmender Ungeduld gewichen, als das versprochene Transportmittel lange Zeit ausblieb. Um halb zehn Uhr fuhr der Jeep gemütlich vor und wurde bald darauf mit reichlich Gepäck und Fahrgästen beladen, was angesichts der engen Platz- und der zu erwartenden schlechten Strassenverhältnisse dem einen oder anderen Passagier Sorgenfalten auf die Stirn trieb.
Darauf fuhren wir los - für etwa fünf Minuten. Dann begann nämlich der zweite Akt dieser kirgisischen Interpretation von 'Warten auf Godot'. Dieser zweite Akt fand auf einem Busparkplatz statt, wo wir für weitere etwa zwei Stunden warteten. Grund: unbekannt.
Sodann wurde ein nächster Anlauf genommen: Wir schafften es bis zur Tankstelle und zum Basar, um Proviant einzukaufen. Darauf wurden wir gebeten auszusteigen, was wir auch taten. Ausserhalb des Fahrzeugs waren wir in der besten Position, um mit offenen Mündern zu beobachten, wie unser Jeep ohne uns, dafür mit unserem Gepäck davondüste. Ich wurde mit lebhaften Gesten zu beruhigen versucht: Es müsse nur etwas besorgt werden, das Fahrzeug käme gleich wieder.
Das tat es dann drei Stunden später auch, so dass wir die Reise um 14 Uhr tatsächlich aufnehmen konnten. Fünf holprige Stunden später erreichten wir Sary Tash, ein kleines Dorf an einer staubigen Weggabelung, wo sich die Strasse teilt und via den Pamir-Highway nach Tadschikistan und via dem Grenzort Irkestan nach China führt. Natürlich war es schon zu spät, um an diesem Abend von Sary Tash aus noch weiter Richtung China vorzurücken.
Von Sary Tash sind es noch lächerliche 70km bis zur chinesischen Grenze. Man könnte fast zu Fuss gehen. Und diese Möglichkeit kommt mir des öfteren in den Sinn und scheint immer realistischer zu werden, als mich am nächsten Morgen nach Stunden des vergeblichen Wartens immer noch kein Lastwagen mitgenommen hat. In meiner Verzweiflung bin ich durch das Dorf gelaufen, in der Hoffnung, ich fände ein funktionierendes Fahrzeug und einen Fahrer, der sich bei einer Taxifahrt einige Dollars (ich war schon bereit, grössere Summen aufzuwerfen) hinzuverdienen wollte.
Dass mein grosszügiges Angebot vom Besitzer eines ziemlich gut in Form scheinenden Jeeps mit einer den miserablen Zustand der Strasse andeutenden Handbewegung abgelehnt wurde, hat meine Hoffnung, China bald zu erreichen, zugegebenermassen nicht gerade gesteigert.
Man muss den Stein, der mir vom Herzen viel, ziemlich weit herum poltern gehört haben, als am frühen Nachmittag des selben Tages ein mit Schrott beladener Lastwagen die Fahrt verlangsamte und mich zum Einsteigen einlud. Später erfuhr ich, dass meine Auto- beziehungsweise Lastwagenstopp-Erfolgsquote mit sechs Stunden Wartezeit sehr gut war, hat doch ein anderer Rucksacktourist am selben Ort geschlagene 36 Stunden auf eine Mitfahrgelegenheit warten müssen.
Für die Fahrt von Sary Tash zum kirgisischen Grenzort Irkestan muss ich nochmals auf die im Kirgistan-Blog erwähnte Lastwagen-Langsamkeit zurückkommen. Denn - unglaublich, aber wahr! - es geht noch langsamer! Wir haben für die 70km, zugegeben, mit einem kurzen Halt zur Zwischenverpflegung, aber glücklicherweise ohne Panne, tatsächlich geschlagene sieben Stunden gebraucht. Einziger Vorteil dabei: Die Durchschnittsgeschwindigkeit lässt sich leicht errechnen.
Lange nach Einbruch der Dunkelheit bin ich dann also in Irkestan angekommen, der Ort mit der für mich magischen Bedeutung, sollte er mir doch den Grenzübertritt nach China ermöglichen.
Am nächsten Morgen hat das Tageslicht dann enthüllt, dass der Ort nicht sehr viel Magisches an sich hat: Irkestan ist nichts anderes als eine wilde Ansammlung von als notdürftige Unterkünfte verwendete Eisenbahnwaggons. Die Waggons sind mit bunten Tüchern heimelig eingerichtet, so dass so etwas wie Zirkus- oder Zigeuner-Stimmung aufkommt. Zudem herrscht ein buntes Kommen und Gehen, denn die Ein-Zimmer-Waggons dienen in der Regel gleichzeitig als Schlafzimmer, Restaurant, Küche und Wohnzimmer. Langweilig wird es nie und kalt nur selten, denn als Heizung wird einfach die elektrische Teekochplatte verwendet, die mit oder ohne Teekrug den ganzen Tag in einer Ecke vor sich her glüht.
Die rund 300 Bewohner des Dörfchens leben faktisch auf einem riesigen Schrottplatz. Diverse grösseren und kleineren Schrotthaufen sind denn auch die einzigen Farbtupfer in der ausgetrockneten Passlandschaft auf weit über 3'000müM. Schrott ist nämlich wie schon in den anderen zentral-asiatischen Ländern auch in Kirgistan eines der 'Hauptexportprodukte'. Und da die kirgisischen Lastwagen aus visatechnischen Gründen nicht nach China fahren können, wird der bis hierher transportierte Schrott von den kirgisischen Lastwagen abgeladen, sortiert und später auf chinesische Lastwagen aufgeladen. Diese transportieren die wertvolle Fracht dann in die Volksrepublik, wo das Altmetall wohl zu Armierungseisen umgeschmolzen wird. Mir scheint es wahrscheinlich, dass auf Grund der massiven Bautätigkeit in China die Nachfrage nach billigem Altmetall nicht ohne Importe befriedigt werden kann.
Der Grenzübertritt selber verlief dann den Umständen entsprechend problemlos, so dass ich mit zwei Tagen Verspätung und zwei Tage vor Ablauf der Einreisefrist dann doch noch chinesischen Boden betrat. "Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein grosser Schritt für Marc", oder wie war das doch gleich schon wieder...? ;-) *
Doch schon die Weiterfahrt auf der chinesischen Seite wurde wieder spannend: Ein Polizist wollte mir wohl eine Lektion erteilen und setzte mich wegen meines, hmm, sagen wir mal 'undiplomatischen Verhaltens' in seinem Dorf faktisch unter Hausarrest, wenn ich seine Bedingungen nicht erfüllte. Das habe ich dann, oh Wunder, auch getan. Ohne in die Details gehen zu wollen, war mir die Message mehr als klar geworden: "Don't mess with the Chinese!" hat mich diese Lektion deutlich gelehrt. Doch glücklicherweise, soviel sei vorweggenommen, war dieses Intermezzo die erste und gleichzeitig auch die einzige unangenehme Begegnung mit der chinesischen Polizei.
In Kashgar angekommen konnte ich dann also doch noch den grossen Grundwasserforscher Philip für meine zweitägige Verspätung persönlich um Entschuldigung bitten. Philip war aber zum Glück nicht nachtragend und wir verbrachten ein paar gemütliche Tage in und um Kashgar mit quatschen, Altstadt bewandern, sowie verwundert an einem Bergsee stehen und fast nicht glauben können, dass die Hügel, die sich um den Karakul-See erheben Siebentausender sein sollen.
* A propos 'Schritte' und 'Menschheit': Wenige Tage nach diesem kleinen Schritt bin ich zusammen mit Philip auf einem Abendspaziergang in Kashgar auf eine grosse Menschenmenge gestossen. Es wurde offenbar etwas gefeiert. Unter Chinas grösster Statue von Väterchen Mao sang ein Chor inbrünstig und mehrhundertkehlig ganz offensichtlich patriotische Lieder. Es ging feierlich zu und her, China liess die Champagnerkorken knallen. Etwas später fanden wir auch den Grund für die Feierlichkeiten heraus: Nach den USA und Russland hat sich auch China ins All vorgewagt und einen ihrer Landsleute in einer Rakete ein paar Mal um die Erde kreisen lassen.
Diese Machtdemonstration ist ein weiteres deutliches Zeichen aus dem Osten: "Wir sind auch wer! Mit uns ist zu rechnen! Wir sind eine Grossmacht, in einem Atemzug mit den USA und Russland zu erwähnen!" scheint es aus allen Ecken zu tönen.
Und finden nicht auch die Olympischen Spiele 2008 in Beijing statt? Und die Weltausstellung 2010? Richtig, in Shanghai wird Tag und Nacht gearbeitet, damit die Welt etwas erleben kann, was noch nicht dagewesen ist.
Es ist eigentlich zu wichtig für eine Fussnotenbemerkung, doch es passt gut hierher: Einer der Gründe für meine Neugier auf China ist folgendes Zitat (es wird Napoleon zugeschrieben): "Wenn China erwacht, wird die Welt erbeben."
Ooops, hat eben die Erde gebebt? Konntet Ihr es auch spüren?
Beijing - so fern und doch so nah
Kashgar, mein erster Aufenthaltsort in China, liegt im Süd-Westen der Xinjiang-Provinz, mit dreizehn Prozent an der Fläche von China die grösste Provinz der Volksrepublik. Xinjiang ist stark muslimisch geprägt und nicht zuletzt deshalb kommt mir diese Gegend noch nicht so richtig chinesisch vor . Der Übergang von den anderen zentralasiatischen Ländern nach China ist fliessend vor sich gegangen. Es ist deshalb für mich sehr einfach nachvollziehbar, dass Xinjiang in den meisten Reiseführern zu Zentralasien gezählt wird.
. Der Übergang von den anderen zentralasiatischen Ländern nach China ist fliessend vor sich gegangen. Es ist deshalb für mich sehr einfach nachvollziehbar, dass Xinjiang in den meisten Reiseführern zu Zentralasien gezählt wird.
Doch ohne Zweifel, Beijing macht seinen Anspruch auf den westlichsten Teil seines Territoriums deutlich geltend. Mir fehlt der Überblick über die tatsächlichen politischen Machtverhältnisse; so ist mir zum Beispiel nicht klar, wie stark die Unabhängigkeitsbewegung in Xinjiang (eigentlich: Xinjiang Uyghur Autonomous Region) wirklich ist. Interessierte finden aber via Internet sicher rasch genug detaillierte Infos. [Pro memoria: dieser Text stammt aus dem Jahr 2006. Die Verschlechterung der Situation der Uiguren in den nächsten 10 bis 15 Jahren ist leider schreckliche Wahrheit geworden.]
Ich kann an dieser Stelle lediglich erwähnen, welche kleine aber feine Details deutlich machen, wie kurz die Leine ist, an der Beijing sein westlichstes Kind hält.
Geografisch gesehen liegt Xinjiang zwei bis drei Zeitzonen vor Beijing. Doch - wie könnte es anders sein - in China gibt es offiziell nur eine Zeitzone und das ist diejenige von Beijing... Somit werden in Xinjiang alle behördlichen Öffnungszeiten gemäss Beijing-Zeit angegeben. Doch daneben hat sich so etwas wie eine Schattenzeit etabliert: Lokale Geschäfte funktionieren nach Xinjiang-Zeit. Nicht immer ganz einfach, da den Überblick zu bewahren.
Auf den langen Fahrten auf den meist hervorragenden Strassen von Xinjiang sind mir am Strassenrand Steine mit folgenden Markierungen aufgefallen:
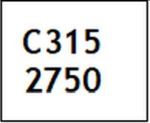
Zuerst konnte ich mir keinen Reim darauf machen, doch spätestens als ich merkte, dass bei Fahrten Richtung Osten die vierstellige Zahl immer kleiner wurde, dämmerte es mir: Was können das anderes sein als Kilometersteine, die die Distanz bis Beijing angeben?!
Viel einschneidendere Bedeutung für Xinjiang als alle derartigen kleinen Seitenhiebe haben sicher die Eingriffe in die Architektur der Städte und in die Veränderung der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung. Altstädte werden plattgewalzt und haben einer chinesischen Einheitsstadt zu weichen, die überall genau gleich öde und leblos aussieht. Die Zutaten dazu sind: Riesige und meist krass überdimensionierte Strassen (vier bis sechs Spuren sind keine Selten-heit), welche durch das neu zum offiziellen Stadtzentrum ernannte Gebiet führen. Dies wirkt besonders darum unpassend, weil die Hauptverkehrsmittel trotzdem immer noch Esel- oder Kamelwagen, Velos und kleinvolumige Motorräder bleiben. Zudem werden am Strassenrand in Windeseile gesichts- und charakterlose Geschäftshäuser errichtet und mit reichlich bunten Reklameschildern überklebt. Unverzichtbar dabei ist eine grosse Anzahl Leuchtgirlanden und sonstiger kitschignerviger, da ganzjährig blinkender Weihnachtsschnick.
Damit die traditionell in Xinjiang ansässigen muslimischen Uyghuren nicht auf allzu dumme Ideen kommen, siedelte Beijing bereits zehntausende von Han-Chinesen in dieser Gegend an, um den chinesischen Einfluss zu verstärken. Es versteht sich von selbst, dass alle wichtigen Stellen in Behörden und Regierung von Han-Chinesen besetzt werden.
But when in Rome... - oder: Über Sitten und Gebräuche
"Chchchchch....pffffttt" tönt es allenthalben. Es wird gespuckt, was das Zeug hält und das wird von niemandem als stossend empfunden. Auf der Strasse sowieso, aber auch im Bus und Restaurant wird - und zwar gleichermassen von Männern und Frauen - die offensichtlich nicht mehr erwünschte Körperflüssigkeit grosszügig ausgesondert. Es fällt auf, es irritiert, es stört. Aber nicht für lange, denn wenn man sich nicht schnell damit abfindet, wird ein längerer Aufenthalt in China sicherlich zur Tortur.
Natürlich wird nicht nur gespuckt, es wird auch gefurzt und gerülpst, dass es eine wahre Freude ist. Keine Scheu und Scham, dass das jemanden stören oder als zu privat empfinden könnte.
Empfindliche Gemüter müssen zudem besonders vorsichtig sein, wenn sie um eine Hausecke laufen: Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich gross, dass man dabei auf eine urinierende Person stösst.
Aber Achtung: Dieses 'anything goes'-Gefühl, das in China unweigerlich aufkommt, täuscht über die wahren Tatsachen hinweg. Es gibt nämlich durchaus Dinge, die man nicht tun sollte. Ein Resultat von solchen ungeschriebenen Gesetzen ist zum Beispiel meine neu empfundene Scheu beim Nase schnäuzen, welches in China als äusserst unhöflich und unanständig gilt. Nicht selten drehen sich die Köpfe in der näheren Umgebung in meine Richtung, wenn ich ein Taschentuch volltrompete. Erlaubt ist jedoch das Schnäuzen mit den Fingern. Ob China etwas gegen den steigenden Verbrauch von Papiertaschentüchern unternehmen will?
Diverse Regeln gilt es auch beim gemeinsamen Essen einzuhalten. Dazu gehört zum Beispiel, dass man sich nie selber Tee einschenken darf, ohne vorher nicht der ganzen Tischgesellschaft nachgeschenkt zu haben. Und ja: Stecke niemals die Essstäbchen in den Reis, denn das ist etwa das Übelste, das man zu Tische tun kann, da es als Gotteslästerung empfunden wird!
Ein Huhn ist ein Huhn ist ein Huhn...
Ich bin mir schon ein bisschen wie ein Darsteller einer mittelmässigen Cabaretnummer vorgekommen, als sich folgende Restaurantszene abgespielt hat:
Zusammen mit einer ebenfalls der chinesischen Sprache nicht mächtigen Touristin bin ich hungrig in einem kleinen Lokal gelandet. Zugegeben, in Nobelrestaurants französischer Herkunft ist es auch nicht immer einfach, hinter all den wenigstens sehr wohlklingenden Beschreibungen etwas Essbares zu vermuten, doch auf einer chinesischen Speisekarte ohne englische Übersetzung sind für mich im besten Fall noch die Preise zu entziffern.
Und der Reise- oder Sprachführer hilft in derartigen Situationen meist auch nicht viel weiter, da es nicht einfach 'Schweinefleisch' oder 'Bambussprossen' gibt, sondern tausend verschiedene Arten, wie die Gerichte zubereitet werden können und entsprechend auch tausend verschiedene Bezeichnungen dafür.
Trotzdem waren wir hungrig genug, mit Hilfe des Sprachführers etwas zu bestellen. Um sicher zu gehen zeigten wir auf das Symbol für 'Huhn' und dazu noch auf irgendein Gemüse.
Eine knappe Stunde später, nachdem alle Chinesen schon gegessen hatten und das Lokal schon fast wieder leer war, erhalten wir das Bestellte. Uns wurde ein riesiger Haufen kleiner Fleischstückchen in einer undefinierbaren Sauce aufgetischt.
Und bei genauerem Hinsehen dann die Bestätigung: Es ist wirklich Huhn, denn der Kopf und der eine oder andere Fuss des Federviehs ist darin deutlich zu erkennen... Beklagt haben wir uns nicht, höchstens geschmunzelt, denn wir haben ja Huhn bestellt - und Huhn erhalten. En Guete!
Doch eigentlich ist das nichts anderes als ehrlich, denn so kann sicher niemand behaupten, dass er oder sie nicht gewusst hätte, was da aufgetischt wird.
Doch das mit dem Hühnchen ist natürlich bloss eine harmloses Erlebnis, wenn ich mich daran erinnere, was auf den Märkten alles angeboten wurde. Dort werden nämlich - es ist wirklich so, wie man es sich vorstellt, ausser vielleicht, dass es noch ein bisschen schlimmer ist - unter anderem Schildkröten (ohne Panzer sehen die armen Viecher schlicht schrecklich aus!), Tintenfische, alle Arten von getrockneten Schlangen und Echsen, sowie ganze Köpfe von allen erdenklichen Tieren angeboten.
Bereits schön säuberlich aufgespiesst gibt's Larven und Käfer, Heuschrecken und Frösche sowie Vogelembrios, die dann über dem offenen Feuer schön knusprig gegrillt werden.
Fische werden vorwiegend in kleinen Bottichen neben den als Verkaufstischen getarnten Schlachtbanken gehalten. Es werden aber so viele Fische in den kleinen Bottichen gelagert (ja, 'gelagert' ist das richtige Wort!), dass sich die Fische eher wie die sprichwörtliche Sardine in der Büchse fühlen müssen. Nicht zuletzt deshalb hat sich etwa jeder dritte Fisch schon mal vorsorglich auf den ebenso sprichwörtlichen Rücken gelegt und bewegt die Kiemen nur noch unregelmässig. Bon Appetit!
Drum kann ich für China, was das Thema Kulinarik angeht, abschliessend folgendes festhalten: Vegetarier werden ist nicht schwer, Vegetarier sein dagegen sehr...
Weniger Schmetterlinge als vielmehr böse Geister im Bauch
Die Tage, an denen ich nicht an mein Verdauungssystem denken musste, haben sich auf dieser Reise mit den anderen wohl etwa die Waage gehalten. Glücklicherweise war es nie wirklich schlimm, nur halt amigs chli unangenehm.
Ich kann gar nicht genau sagen, woran es lag. An meiner schwachen Konstitution? Oder an der mangelnden Vorsicht, da meist die Neugier gegenüber der Vernunft überwog und halt vieles, das da am Strassenrand vor sich hinkochte, -brutzelte, -schmorte einfach probiert werden musste?
Eigentlich egal, denn die Chancen stehen gut, dass ich diese Reise, was mein körperliches Befinden angeht, unbeschadet überstehen werde. Und wenn ich bedenke, dass mein Verdauungsapparat durchschnittlich jeden zweiten Tag anderen Gewürz- und Hygienegewohnheiten ausgesetzt ist, dann kann ich nur sagen: "Chapeau, lieber Magen-Darm-Trakt, du hast dich tapfer gehalten."
Zug fahren in China
Zug fahren ist in China wirklich der Weg, um sich fortzubewegen. Die Züge sind etwa so furchterregend pünktlich, wie es die SBB vor langer Zeit mal waren, zudem schnell, komfortabel und dazu erst noch günstig. Im Preis inbegriffen sind noch die Vorführung einiger die kommunistische Vergangenheit des Landes verdeutlichende Szenen, die alleine schon das Zugbillett wert wären.
Die Bahnbeamten sind nämlich nicht in erster Linie Freund und Helfer von verwirrten Reisenden oder Anlaufstellen für Fahrplanauskünfte, sondern vielmehr gestrenge Polizisten, die die Zugreisenden weniger als Kunden, denn vielmehr als unmündige Kinder zu betrachten scheinen. Kinder, die man peinlich genau beaufsichtigen, erziehen und falls nötig auch bestrafen muss.
Die Reisenden mit einem gültigen Billett dürfen den Bahnsteig frühestens eine halbe Stunde vor Einfahrt des Zuges betreten. Allein schon das Zeichen, dass der Bahnsteig nun betreten werden kann, löst eine solche Unruhe im Wartesaal aus, ein solches Gedränge, Gestosse und Geschiebe, man könnte meinen, ein zwanzigplätziger Sonderzug ins Paradies stehe zur Abfahrt bereit.
Auf dem Bahnsteig müssen sich die Passagiere dann schön säuberlich in Einerkolonnen einreihen, um die Einfahrt des Zuges abzuwarten. Diese Kolonnen sind in der Regel so eingerichtet, dass jede Person bereits am richtigen Ort steht, also nicht mehr lange seinen Wagen suchen muss. Bei der Einfahrt des Zuges dann erneutes Geboxe und Ellenbogen-Ausfahren; denn trotz fix zugewiesenem Sitz- oder Liegeplatz spielen sich wilde Kampfszenen ab, um das Privileg, als erster den Zug besteigen zu können. Ob es wohl nicht genug Stauraum hat? Ob der Ersteingestiegene eine Tapferkeitsmedallie 2. Ranges erhält? Oder ob der Zug schon mal abgefahren ist, bevor alle Passagiere eingestiegen sind? Die Gründe für die Hektik sind mir bis heute verborgen geblieben.
Im Zug drin herrscht dann ebenfalls ein fleissiges Treiben: Es wird Tee aufgegossen und die allgegenwärtigen Instantnudeln werden zubereitet und geschlürft, Karten gespielt und geschnarcht. Und das Gute ist, man kann absolut unvorbereitet in den Zug steigen, denn es gibt fast nichts, das einem von den häufig vorbeiziehenden Wägelchen nicht angeboten würde: Diverse warme Gerichte, abgepackte Süssigkeiten, Trockenfleisch, Getränke, Lese- und Hygienematerial, um nur eine Auswahl zu nennen.
Und wenn den Passagieren das im Zug Angebotene trotzdem nicht passen sollte: Kein Problem, jede Haltestelle bringt neue Möglichkeiten, da auf den Bahnhöfen aus allen Richtungen Handwagen vor die Waggontüren herangekarrt werden, wo Früchte, Getränke, Klopapier und vieles anderes angeboten wird.
Bei Zugreisen stehen zwei Ticket-Kategorien zur Auswahl: Hard-Sleeper und Soft-Sleeper. Das Harte am Hard-Sleeper Wagen ist weniger das Bett als die Tatsache, dass es sich bei dieser Reiseklasse um Waggons mit offenen Abteilen handelt, welche aus je zwei hoch drei Kajüten-Betten pro Abteil bestehen. Im Soft-Sleeper befinden sich die Betten in abgeschlossenen Zweier- oder Viererabteilen für ungefähr den doppelten Preis, dort ist zudem die Nachtruhe genau geregelt, da um Punkt 22.00 Uhr das Licht und die Lautsprecher abgestellt werden. Am Morgen, meist kurz vor der Ankunft am Reiseziel, wird der Zugpassagier dann mit modern-traditionellem China-Pop geweckt, so etwas wie Meditationsmusik von DJ Bobo mit Wassergeplätscher im Hintergrund.
Doch richtig fertig ist die Zugfahrt erst nach dem Verlassen des Bahnhofs, da man dazu nochmals eine Schranke durchlaufen muss, wobei die Fahrkarte kontrolliert wird. Ein bisschen ungewohnt, finde ich auch. Aber irgendwann habe ich aufgehört, mich zu wundern.
Alles ist relativ
Nach 22 Stunden und 1’400km Ostzugfahrt in meinem ersten chinesischen Schlafzug steige ich entspannt und voller Erwartung in «meiner» ersten chinesischen Millionenstadt aus. Lanzhou ist ihr Name.
Noch nie gehört? Ich vorher auch noch nicht. Aber wenn eine Stadt in China mehr als eine - oder wie diese hier zweieinhalb - Millionen Einwohner hat, dann ist das halt wirklich nichts Besonderes. Oder wie es im 'Lonely Planet China' diesbezüglich treffend (vielleicht war es auch ein Versehen) heisst:
Xianyang
pop. 4'730'500
'This little town is...
Auto- und Velofahren in China
Erstaunlich und - für ein so reguliertes Land wie China - irgendwie auch erfreulich chaotisch, wild, ja anarchisch geht es auf den Strassen des Landes zu und her.
Der Verkehr auf und neben den Verkehrswegen scheint für den Neuankömmling auf den ersten Blick sehr aggressiv, höchst gefährlich, ja halsbrecherisch. Es herrscht ein chaotisches Durcheinander. Es wird gehupt, was das Zeug hält, in jeder Situation wird vorgedrängt, überholt, hineingepresst. Ganz klar, es herrscht das Gesetz des Stärkeren, des Schnelleren. Wer nachgibt und bremst hat verloren, kommt nicht weiter, muss einen Strom von Fahrzeugen passieren lassen, dessen Lenkerinnen und Lenker gierig und geschickt nur darauf gewartet haben, dass sich eine kleine Lücke im Verkehrsstrom auftut. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Ampel gerade auf rot oder grün steht.
Doch bei genauerem Hinsehen und bei aktiver Teilnahme am Geschehen merke ich schnell, dass es keine bösartige Aggressivität ist. Mir scheint es eher, dass es sich dabei um einen sportlichen, mit einem Augenzwinkern durchgeführten Wettkampf handelt.
Und bei diesem Wettkampf muss man effektiv zu jedem Zeitpunkt damit rechnen, dass aus jeder möglichen Richtung ein Fahrzeug daherkommt. Und ganz offensichtlich ist darüber auch niemand überrascht, denn jede und jeder kennt die Spielregeln. Und es funktioniert, denn Unfälle musste ich trotz diesem wilden Durcheinander keinen einzigen beobachten.
Klar, es gibt Ampeln und in den grösseren Städten zusätzlich an jeder Kreuzung ein gutes Dutzend Polizisten oder andere nicht so hochrangige Verkehrsregeleinhaltungshüter, die ausgerüstet mit Fähnchen und Trillerpfeife - nicht selten erfolglos - versuchen, Velofahrer und Fussgänger an die Regeln zu mahnen.
Die Lichtsignale (hier mal stellvertretend für die vielen verwendeten Helvetismen ein kleines [schweiz.], damit die österreichischen und deutschen Leserinnen und Leser begründet schmunzeln können), sind oft besonders moderne Exemplare, wo den Verkehrsteilnehmern mittels eines Count-Downs angezeigt wird, wie lange die Grün- beziehungsweise Rotphase noch dauert. Doch trotz allen technischen Spielereien, niemand scheint sonderlich beeindruckt von den Lichtsignalen zu sein und betrachten diese ganz offensichtlich mehr als eine Art Vorschlag. Es ist rot, man könnte also vielleicht anhalten, zwingend ist das aber sicher nicht...
Alle Verkehrsteilnehmer haben, mit Ausnahme der Fussgänger, etwas gemeinsam: Sie können hupen und tun das auch ausgiebig.
Das Hupen ist zwar oft ohrenbetäubend (gewisse Lastwagen-Hupen erreichen Werte, da müsste mein Studienkollege und Lärmschutzexperte Oliver schon sein grösstes Lärmmessgerät auspacken...) und kann schnell auf die Nerven schlagen. Die Botschaft der Hupenden kann frei übersetzt als einen Hinweis mit folgendem Inhalt gedeutet werden: "Achtung, ich komme, pass für einen Moment auf und mach keine unnötigen Schwenker".
In einer lange zurückliegenden Vorlesung habe ich einmal gelernt, dass bei der Erzeugung von Lärm Energie benötigt und gleichzeitig Wärme erzeugt wird. Hier in China drängt sich mir nun die Frage auf, ob die Klimaforscher nicht einen wichtigen Faktor bei der Ursache der Klimaerwärmung übersehen haben...
Kein Land, ein Universum
Aufmerksame Leserinnen werden es bemerkt haben: Auf Grund der Beschreibungen ist es eher schwierig, die  eigentliche Reiseroute nachzuvollziehen. Mir scheinen die Alltagserlebnisse im Universum China wichtiger als reine Reiserouten-Beschreibungen und darum werde ich in der Folge noch einige Episoden aus dem östlichsten Teil Chinas (in China gilt übrigens die Regel: Je östlicher desto Kapitalismus...) aufführen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind und für mich zu diesem Aufenthalt in China gehören.
eigentliche Reiseroute nachzuvollziehen. Mir scheinen die Alltagserlebnisse im Universum China wichtiger als reine Reiserouten-Beschreibungen und darum werde ich in der Folge noch einige Episoden aus dem östlichsten Teil Chinas (in China gilt übrigens die Regel: Je östlicher desto Kapitalismus...) aufführen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind und für mich zu diesem Aufenthalt in China gehören.
Für alle interessierten «Reise-auf-der-Karte-Nachgucker» der Vollständigkeit halber hier trotzdem noch im Zeitraffer die hauptsächlichen Stationen während dieses rund sechswöchigen Chinaaufenthalts:
Kashgar - Karakul Lake - Yarkand - Hotan - Korla - Turpan - Lanzhou - Xiahe - Xian - Chongqing - auf dem Jangtse bis Yichang - Wuhan - Nanjing - Shanghai - Beijing.
Verkaufsdialog 1
Situation: Beijing, in einer engen Gasse mit vielen Souvenirständen, Verkaufspersonal und Passanten. Passant schlendert durch die Stände hindurch.
Verkäuferin: "Looka! Mista, looka!"
Passant nähert sich der Auslage und betrachtet das Angebot.
Verkäuferin (hält dem Passanten einen unförmigen goldenen Buddah vor die Nase): "Do you like this?!"
Passant: "No, thank you."
Verkäuferin: "I give you cheaper!"
Verkaufsdialog 2
Situation: In einer Einkaufsstrasse mit vielen Marktständen. Verkäuferin, Passant. Passant beugt sich interessiert über die Auslage, betrachtet ein T-Shirt.
Verkäuferin: "Looka, looka! Very cheap!"
Passant: "I like it, how much is it?"
Verkäuferin: "For you, I give very cheap!" (Holt einen Taschenrechner hervor - das wichtigste Hilfmittel einer jeden Souvenirverkäuferin - und tippt 85 ein. [85 RMB entspricht rund 15 CHF]. "Eighty-five."
Passant (runzelt die Stirn): "Wow... that's very expensive!"
Verkäuferin: "Okee, okee, i give you very cheap. 70."
Passant (immer noch unzufrieden): "No, that's too much!"
Verkäuferin: "Okee, you tell the price!"
Passant (tippt auf dem Taschenrechner eine eins und eine null): "Ten".
Verkäuferin (lacht): "Oh, no, impossible. I give you for 50, last price!"
Passant: "15".
Verkäuferin: "Okee, 35, last price!"
Passant: "Sorry, i don't want it for 35." Entfernt sich vom Stand.
Verkäuferin (nach wenigen Sekunden, laut): "Wait, mister, okee, 15."
Passant (kommt zum Stand zurück und erhält für den ausgehandelten Betrag das T-Shirt): "Thank you."
Keine Angst, es ist nur ein...
Friedlich spaziere ich auf der Uferpromenade von Shanghai und geniesse die eindrückliche Aussicht auf die Skyline der Hochhäuser im neuen Stadtteil Pudong. Die Uferpromenade befindet sich beim 'Bund', dem trockengelegten Teil des Huangpu Flusses. Eine frische Brise weht mir um den Kopf, die vielen Touristen aus allen Gegenden der Welt geniessen wie ich den tollen Tag.
Aus der Menge nähert sich mir ein Mann im dunklen, langen Mantel. Die Hände in den Manteltaschen versteckt, das Gesicht unter der Mütze kaum zu erkennen.
Noch immer kann ich nicht sagen, ob er nur zufällig in meine Richtung läuft, oder ob er etwas von mir will. Doch plötzlich wird auch der letzte Zweifel ausgeräumt. Mit ein-zwei schnellen Schritten legt er die letzte Strecke zwischen uns zurück, öffnet mit einem schnellen mich erschreckenden Ruck den Mantel und flüstert: "Rolex, Omega, Rolex?! Very cheap!"
Geschickt betrogen ist halb gelacht
Im öffentlichen Bus von Downtown Xian zur Qin Terracotta Armee (welche gemäss dem offiziellen Werbeslogan von China Tourismus auch als das 'achte Weltwunder' bezeichnet wird) werde ich von einem fliegenden Zeitungshändler angesprochen. Mit einem Schmunzeln gebe ich ihm zu verstehen, dass mir chinesische Zeitungen nicht viel nützen und WC-Papier hätte ich schon.
Doch er nicht faul, zückt sogleich ein Exemplar von 'China Daily', der regimegetreuen englischen Tageszeitung, hervor. Da ich schon lange keine Zeitung mehr gelesen habe, will ich mir diese Zeitung kaufen. Dort drauf steht als Preis '1 Yuan'. Als ich dem Händler diesen Betrag aushändigen will, weist er mich darauf hin, dass die Zeitung aus Beijing käme, und darum zwei Yuan koste. Hab mich schon ein bisschen gewundert, doch nicht nachgehakt, denn ob die Zeitung 20 oder 40 Rappen kostet, war mir in diesem Moment grad nicht so wichtig.
Nach den Tonfiguren in der Turnhalle ist mir die Sache mit der Zeitung nochmals durch den Kopf gegangen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil ich gerade festgestellt hatte, dass ich die Ausgabe von gestern in den Händen halte. Ganz schön frech, aber irgendwie auch gut, musste ich zugeben, verkaufte doch der Typ einem naiven Touristen die Zeitung von gestern zum doppelten Preis.
Und wenn er nicht erfroren ist, dann...
Angesichts des eher engen Reiseprogramms für die letzten Wochen sehe ich momentan keine (stressfreie) Möglichkeit, den Rhythmus 'erstelle für jedes besuchte Land einen Blog-Eintrag' aufrecht zu erhalten.
Bei den letzten Wochen handelt es sich ja auch nicht viel mehr als um die - mit ein paar Zwischenstopps verschnörkelte - Heimreise auf dem mehr oder weniger direktesten Weg.
 Daher jetzt schon ein kurzer Überblick über die auf dem Plan stehenden Stationen. Die Konstante wird dabei wohl sein, dass ich mir ziemlich überall den Allerwertesten abfrieren werde, bei zu erwartenden Temperaturen von ungefähr 20 Grad auf der falschen Seite des Nullwertes.
Daher jetzt schon ein kurzer Überblick über die auf dem Plan stehenden Stationen. Die Konstante wird dabei wohl sein, dass ich mir ziemlich überall den Allerwertesten abfrieren werde, bei zu erwartenden Temperaturen von ungefähr 20 Grad auf der falschen Seite des Nullwertes.
Von Beijing aus reise ich auf der transmongolischen Eisenbahnlinie bis in die mongolische Hauptstadt Ulan Bator, wo ich bei einem Zwischenhalt einen Eindruck von der Mongolei erhalten will.
Von dort geht es weiter nach Russland mit einem ersten Halt am Baikalsee in Irkutsk , wo ich - leider - nicht Eisfischen gehen kann, denn dafür ist es Anfangs Dezember noch zu wenig lang genug kalt gewesen. Doch ich bin sicher, es gibt genügend Alternativen in dieser interessanten Gegend beim grössten Süsswasserreservoir dieses Planeten.
, wo ich - leider - nicht Eisfischen gehen kann, denn dafür ist es Anfangs Dezember noch zu wenig lang genug kalt gewesen. Doch ich bin sicher, es gibt genügend Alternativen in dieser interessanten Gegend beim grössten Süsswasserreservoir dieses Planeten.
 Nach einer längeren Zugfahrt will ich dann auf dem Roten Platz in Moskau versuchen, ob ich den Kopf- beziehungsweise Handstand noch kann. Falls dann noch genug Saft und Kraft, Zeit und Lust in mir ist, will ich mir auch noch eine Schlittschuhfahrt auf den hoffentlich zugefrorenen Kanälen von St. Petersburg gönnen, bevor sich dann der Reisekreis in Wien schliessen wird. Und von dort ist es ja nur noch einen Katzensprung oder Steinwurf bis ins heimische Züri.
Nach einer längeren Zugfahrt will ich dann auf dem Roten Platz in Moskau versuchen, ob ich den Kopf- beziehungsweise Handstand noch kann. Falls dann noch genug Saft und Kraft, Zeit und Lust in mir ist, will ich mir auch noch eine Schlittschuhfahrt auf den hoffentlich zugefrorenen Kanälen von St. Petersburg gönnen, bevor sich dann der Reisekreis in Wien schliessen wird. Und von dort ist es ja nur noch einen Katzensprung oder Steinwurf bis ins heimische Züri.
14. Dezember 2003
Vienna again (Österreich)
Ein Kreis schliesst sich in Wien
Nach den unmenschlich vielen nigelnagelneuen 7er BMWs, die mit Blaulicht auf den Gegenfahrbahnen der meist völlig verstopften Strassen Moskaus hinter verdunkelten Scheiben ganz offensichtlich extrem wichtige Persönlichkeiten zum nächsten überteuerten Restaurant oder in den gerade angesagtesten Nachtclub mit 'the best Russian lap-dancing girls' chauffierten, wirkt Wien geradezu provinziell. (Es ist sogar erstaunlich, dass dieser gutmütige Wiener Computer es zulässt, dass ein so komplizierter, den Leser oder die Leserin wohl atemlos zurücklassenden Satz überhaupt abgespeichert werden kann.)
Die Restaurants hier in Wien heissen weder 'Embassy Club' noch 'Safari Lodge' sondern 'Kaiserziegel' oder 'Knechtl', das Ottakringer gibt's in den Beisln und das Brot hol ich mir beim Anker.
Aus dem Lautsprecher der Strassenbahn kündet eine gemütliche Stimme die nächste Station mit 'Sozialversicherungsanstalt der Bauern' an. Wenn das nicht Mut macht und Hoffnung gibt, dass das Gute doch noch siegen wird...
Kein unnötiges Gedränge mehr, denn anstatt dass er, wie es der Moskauer tut, die Ellenbogen ausfährt, tritt der Wiener höflich zurück und überlässt der Nachbarin den Vortritt, Türen werden aufgehalten statt vor der Nase zugeschmettert.
Und das Beste kommt erst noch: Es gibt wieder Tastaturen, die die vertrauten zwei Pünktchen auf den O's, A's und U's führen. Jüdihüi! *
* Im Rahmen der leserinnenfreundlichen Überarbeitung des Dokuments wurde die korrekte Darstellung der Umlaute nachträglich wieder hergestellt. Bei der Erstellung eines grossen Teils dieser Episoden liessen die verfügbaren Tastaturen eine Darstellung der Umlaute nicht zu (oder wenigstens kannte ich die einschlägigen Tastenkombinationen nicht…).
Halt, da war doch was... Ja klar, ich war erst vor ein paar Monaten schon einmal in Wien. Ich mag mich sogar gut daran erinnern: Bei einem gemütlichen Bier im legendären Flex durfte ich im Kreis einiger lieber Leute ein paar entspannte Stunden verbringen.
Als das Gespräch auf die weiteren Stationen meiner Reise kam, stellten die in der Ostgeographie sehr bewanderten Viennesen folgendes fest: «Also wenn Du auf dem Rückweg in Moskau Halt machst und von dort nach Zürich fährst, tja, dann führt eigentlich kein Weg an Wien vorbei. Und deshalb wär's doch schön, wir würden uns vornehmen, in Wien irgendwann im Dezember zum Abschluss deiner Reise wieder zusammen ein Bier zu trinken.»
Marc: «Hmm, tönt verlockend... Ist zwar noch ein bisschen weit weg, jetzt im Juli, quasi zu Be-ginn meiner Reise, schon über ein mögliches Ende nachzudenken. Aber, klar, schön, wenn's klappen würde!»
Und nun - einige Monate sind seit diesem Dialog vergangen - steht dieses Treffen nur ein paar wenige Stunden bevor, denn meine Reise neigt sich dem Ende zu und der Kreis beginnt sich zu schliessen. Mensch, wie die Zeit vergeht!
Da fällt mir noch eine kleine Geschichte ein (oder sagt man dem ‚Gedicht’?), die mir irgendwann im Verlauf dieser Ostreise in den Sinn gekommen ist:
Reisen und Berge
Sich vor dem Antritt einer grossen Reise befinden
Ist wie am Fuss eines hohen Berges stehen
Unbezwingbar. Undenkbar. Viel zu hoch. Viel zu weit. Viel zu schwierig.
Vielleicht sogar gefährlich! ruft es, denkt es.
Doch dann, sobald der erste Schritt getan
Wird bereits die Möglichkeit für den nächsten deutlich
Und so geht's immer weiter, als wär's die einfachste Sache der Welt
Dabei bleibt erst noch viel Zeit, die Landschaft zu betrachten
Die Aussicht zu geniessen, tief durchzuatmen
Die Gesichtszüge der Menschen fliessen ineinander über, die Sprachen ebenso
Fort ist die Angst, verschwunden sind die Zweifel!
Doch ab und zu passiert ein Missgeschick, ein Fehltritt sozusagen
Herzklopfen! Was jetzt? Gibt es einen Ausweg?
Kein Problem: Ein oder zwei Schritte zurücktreten. Lage beurteilen.
Nachfragen. Rat einholen. Schlüsse ziehen. Und weiter geht's!
An Ende der Reise oder wieder am Fuss des Berges angekommen
Bleibt einzig die Frage: Wie konnte ich nur zweifeln und bangen?
Doch ein erster vorsichtiger Blick zurück macht deutlich
Dass das Bangen schon seine Gründe hatte
So weit? So hoch? So lang?
Und schon wieder zurück!
Wie das nur möglich war?